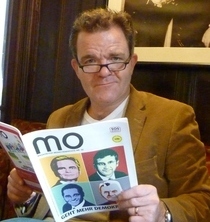Auf der Straße
Der Dokumentarfilm "Zu ebender Erde" begleitet ein Jahr lang Menschen, die keine Wohnung haben. Eine Langzeitbeobachtung. Text: Gunnar Landsgesell, Foto: Stadtkino
Zwischen Weihnachten und Neujahr, tiefster Winter. Aus einem verschneiten Holzhaufen schält sich eine Frau hervor. Sie schimpft, es ist bitterkalt. Mit einer Bürste kämpft sie sich durch die „Botanik“ in ihren Haaren, wie sie sagt. Sie ist eine Kämpferin, die erstaunlich unbeschadet und aus freien Stücken ein Leben außerhalb der Gesellschaft, an den Rändern der Stadt, im Freien führt. Später trifft man sie in einem Uni-Hörsaal wieder, wo sie einer Vorlesung über Klimawandel und Kochtechniken in Entwicklungsländern lauscht. Als sie sich zu Wort meldet, kritisiert sie die Re-Ökonomisierung des Westens, die denen, die es brauchen, eh nichts bringt.
Obdachlosigkeit hat viele Gesichter. Das ist eine der Erkenntnisse, die man aus der Langzeitbeobachtung „Zu ebener Erde“ zieht. Vier Jahreszeiten lang hat das Regie-Trio Birgit Bergmann, Steffi Franz und Oliver Werani verschiedene von Wohnungslosigkeit betroffene Menschen begleitet. Nicht immer wird klar, welche Umstände sie in ihre Situation gebracht haben. Alkoholismus mag eine der Ursachen sein, aber es ist nicht die einzige. Unmerklich schält sich heraus, dass die Personen, die hier porträtiert werden, ihre ganz eigenen vertrackten Biographien haben. Der uniforme Blick auf „Obdachlose“ spaltet sich unweigerlich auf. Die Stadt wiederum präsentiert sich aus deren Perspektiven neu.

„Zu ebener Erde“ möchte sein Publikum nicht mit möglichst umfassender Information versorgen. In manchen Momenten erinnert der Film auch an die Tradition des Direct Cinema, das sich primär für die Unmittelbarkeit des Moments interessierte und die Inszenierung der Bilder auf ein Minimum beschränkte. Immer wieder bezieht man sich hier aber auch direkt auf die Kamera. Bei einem Paar aus der Slowakei, die Frau sitzt im Rollstuhl, der Mann greift gerne zur Flasche, wollen die FilmemacherInnen offenbar wissen, wie die Frau auf die Straße gekommen ist. „Wie bist du auf die Straße gekommen?“, greift der Partner die Frage auf und stellt sie immer wieder an die Frau. Während er insistiert, verweigert sie die Antwort. Die Stimmung ist plötzlich gereizt, es wird einem klar, das Leben auf der Straße lässt einen Rückzug ins Private kaum zu. Auch nicht für Menschen, die ab und zu den öffentlichen Raum mit einer Notschlafstelle tauschen.
Wie man mit der Stigmatisierung von Randgruppen wie Obdachlosen umgeht, ist unweigerlich eine der Fragen eines solchen Filmprojekts. „Zu ebener Erde“ findet eine gute Balance, auf die Originalität der Leute einzugehen, ohne sie vorzuführen. Dem Mann mit dem weißen Bart, der Pelzmütze und der verwaschenen Sprache sind wir ein dankbarer Begleiter. Schnaufend ist er bereit, sich seinem Publikum mitzuteilen. Wir hören ihm zu, wie das mit dem Pfand der Flaschen ist, die er einsammelt, oder sehen zu, wie er sich mühsam in einer Einrichtung auszieht, um zu duschen. Auch an seiner Person wird die Distanz zur übrigen Gesellschaft deutlich, etwa, wenn er in die U-Bahn einsteigt und von der Kamera mit feiner Ironie beobachtet wird. Da sieht man den alten Mann in der U-Bahn sitzen, den Körper nach vorne gebeugt, er ist eingeschlafen. Neben ihm sitzt jemand mit genau der gleichen Körperhaltung, doch der liest in seinem Handy. Und während der eine vielleicht nach Hause fährt, ist auch der andere unterwegs.
„Zu ebener Erde“ ist ab 28. September in den Kinos zu sehen.
Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo