
Kampf um Tisch und Kuchen
Gelungene Integration führt zu einem harmonischen Zusammenleben? Im Gegenteil, meint der deutsche Soziologe El-Mafaalani. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Interview: Milena Österreicher, Fotos: Mirza Odabasi
Aladin El-Mafaalanis Buch „Das Integrationsparadox. Warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt“ erregte 2018 viel Aufmerksamkeit. Die Grundthese des deutschen Soziologen und Erziehungswissenschaftlers: Je gelungener die Integration benachteiligter Gruppen, desto mehr Konflikte gibt es. Mittlerweile ist eine erweiterte und überarbeitete Neuausgabe erschienen. 2020 veröffentlichte der Autor, der an der Universität Osnabrück den Lehrstuhl für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft innehat, sein Buch „Mythos Bildung: Die ungerechte Gesellschaft, ihr Bildungssystem und seine Zukunft“. Im September erscheint sein neues Buch „Wozu Rassismus?“.

„Die Tischgesellschaft ist jünger geworden, offener und bunter. Jetzt sitzen da auf einmal viel mehr Menschen, die ein Stück vom Kuchen möchten.“
Herr El-Mafaalani, warum führt gelungene Integration zunächst zu mehr Konflikten?
Ich beschreibe es im Buch mit einer Metapher. Stellen wir uns die Gesellschaft als einen Raum vor. In diesem Raum sitzen manche Menschen an einer großen langen Tafel, andere am Boden, manche am Rand. An der großen Tafel – die symbolisch für die volle Teilhabe in der Gesellschaft steht – saßen vor Jahrzehnten nur wenige Menschen. Sie waren älter und alles Männer.
Im Laufe der Jahrzehnte setzten sich viele andere Menschen an den Tisch, vor allem Frauen, aber auch Menschen mit internationaler Geschichte (Migrationshintergrund). In Deutschland gab es bei Frauen und Menschen mit internationaler Geschichte übrigens mehr Zuwächse als in Österreich. Menschen mit Behinderung und LGBTQ*-Menschen kamen hinzu. Die Tischgesellschaft ist jünger geworden, offener und bunter. Jetzt sitzen da auf einmal viel mehr Menschen, die ein Stück vom Kuchen möchten.
Wofür steht der Kuchen?
Soziologen würden zu diesem Kuchen „Ressourcen“ sagen. Also Zugang zum Bildungssystem, Chancen auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt, etc. Die Menschen wollen aber nicht nur vom Kuchen essen, sondern auch einen schönen Platz am Tisch, also eine gute soziale Position. Wer nun denkt, dass es in dieser Situation harmonischer werden soll, hat nicht ganz verstanden, was daraus folgt. Wenn alle ein Stück vom Kuchen und einen schönen Tischplatz wollen, führt das zu sozialen und ökonomischen Konflikten.
Und was noch hinzukommt: Wenn die Neuen länger mit am Tisch sitzen, fangen sie an, unangenehme Fragen zu stellen. Zum Beispiel – um bei der Metapher zu bleiben –, ob das überhaupt der richtige Kuchen ist, ob das Rezept stimmt, ob die Tischordnung und die Esskultur richtig sind. Sie stellen Fragen, die die intimsten Sphären der Tischgesellschaft betreffen. Es geht um kulturelle Fragen, um Identität, Identifikation und Deutungshoheit. Wer bestimmt, was richtig oder falsch ist und wohin die Reise gehen soll?
Zusammengefasst: Wir haben ein enorm erhöhtes und vielfältiges Konfliktpotenzial, weil es in Hinblick auf die Teilhabe von Menschen ziemlich gut läuft bzw. in die richtige Richtung geht. Integration ist dann gelungen, wenn Menschen die Gesellschaft mitgestalten möchten.
In Ihrem letzten Buch geht es um Bildung. Welche Rolle spielt sie in diesem Emanzipationsprozess?
Um bei der Metapher zu bleiben: Bildung ist das wichtigste Medium, um an den Tisch zu kommen – ganz abgesehen von den positiven Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und Ähnliches. Heutzutage sitzen mehr Menschen am Tisch, weil sie Kompetenzen haben, Schulabschlüsse vorweisen können, sich aktiv einbringen und mehr Gehör verschaffen. Daran ist Bildung maßgeblich beteiligt. Aber sie löst nicht alle Probleme.
Es ist sehr erfreulich, dass jetzt so viele am Tisch sitzen. Gleichzeitig geht es den wenigen, die immer noch am Boden verbleiben, so schlecht wie nie. Es gibt nichts Schlimmeres, als mit nur wenigen auf dem Boden zu sitzen. Als die Mehrheit noch dort unten war, gab es solidarische Strukturen, Arbeiterstolz, Tradition etc. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und habe das noch mitbekommen, die Arbeiterbibliotheken, die Arbeiterchöre … Jetzt sind immer mehr an den Tisch gegangen, und die solidarischen Strukturen am Boden haben sich aufgelöst. Die Menschen dort mussten zusehen, wie sich fast alle an den Tisch gesetzt haben, außer man selbst. Und dann passiert folgendes, und das in fast allen Ländern: Die Menschen am Tisch – auch die, die neu hinzugekommen sind – erzählen die Geschichte, dass sie eine super offene Gesellschaft sind, und jeder, der sich Mühe gibt, sich dazusetzen kann. Das heißt im Umkehrschluss, wer auf dem Boden sitzt, hat es auch nicht verdient, am Tisch zu sein. Selbst schuld sozusagen. Das führt dazu, dass die Menschen, die am Boden sitzen, resignieren. Sie sehen keine positive Zukunft mehr. Migrantische Milieus, die auf dem Boden sitzen, bilden Parallelgesellschaften. Migranten haben ja nicht ihre Heimat verlassen, um in der Fremde zu resignieren. Wenn die solidarischen Strukturen wegbrechen, bilden sie eigene solidarische Strukturen. Sie suchen nach einem Weg und im Notfall auch einen „eigenen“ Weg, der dann häufig der aufnehmenden Gesellschaft nicht gefällt. Parallelgesellschaftliche und resignative Strukturen nehmen zu, weil es gut gelaufen ist. Das ist das Gesamtparadoxon.

Anfangs wurde meine These in „Das Integrationsparadox“ als provokant oder als optimistisch bezeichnet. Interessant ist, dass seit 2020 das „provokant“ weggefallen ist.
Sie erwähnen, dass Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte in Österreich im Vergleich zu Deutschland weniger Teilhabe haben. Woran liegt das?
Ich beobachte, dass Österreich sich öffnet. Es geht in eine gute Richtung, aber langsam. In Deutschland ist das enorm schnell passiert. Österreich hat eigene Spezifika, zum Beispiel leben die meisten Menschen in ländlichen Regionen. Es gibt mit Wien und Graz nur ein, zwei wirkliche Ballungszentren, wo Urbanität herrscht.. In Deutschland gibt es beispielsweise 80 Städte, die als Großstadt gelten. Großstädte zeichnen sich dadurch aus, dass Menschen sich nicht kennen, sich fremd sind. In der Großstadt staunt man, wenn man zufällig jemanden trifft, den man kennt. Auf dem Land staunt man, wenn man jemanden sieht, den man nicht kennt. Das sind entgegengesetzte Voraussetzungen. In einer Metropole ist man auf Fremdheit strukturell angewiesen und kann damit gut umgehen.
Auf dem Land leben Menschen gerne, weil sie es übersichtlich, gemütlich und bekannt mögen, und das ist auch völlig berechtigt. Es führt aber dazu, dass man aufgrund dieser regionalen Begebenheiten auch weniger Möglichkeiten hat, sich in Offenheit gegenüber Fremdem zu üben.
Und auf politischer Ebene?
In Deutschland gab es zunächst keinen Populismus. Österreich hat ja schon lange mit der FPÖ, die einmal liberal war und dann ziemlich populistisch wurde, zu tun. In Deutschland hatte man im Prinzip die ganze Zeit eine große konservative Partei, die CDU, die doch sehr demokratisch ist, dafür aber mehrere linke Parteien.
Dann muss man thematisieren, dass in Deutschland ein Teil der eigenen Geschichte aufgearbeitet wurde. Alle Nationen haben in ihrer Geschichte finstere Phasen. Keine so schlimme wie Deutschland, aber dennoch. Ich glaube, das spielt in Österreich eine Rolle: ein gewisser Nationalismus und eine noch ungenügende Aufarbeitung der Geschichte.
Und zu guter Letzt denke ich, dass die deutsche Gesellschaft durch soziale Bewegungen, wie die Jugendbewegung, die Frauenbewegung, die Umweltbewegung und die Gastarbeiter stark geprägt wurde. Sie haben viele Dinge im Alltag aufgebrochen, die vorher starr und verschlossen waren. 1990 kam dann noch die Wiedervereinigung dazu, die die deutsche Gesellschaft nochmals aufgerüttelt hat.
Zurück zur Tischmetapher: Wenn nun mehr Menschen am Tisch sitzen – also volle Teilhabe an der Gesellschaft haben – wird das Kuchenstück für jeden kleiner.
Weder der Kuchen noch die einzelnen Stücke müssen kleiner werden. Wir wissen, dass sowohl in Deutschland als auch in Österreich die Einwohnerzahl nicht signifikant gestiegen ist. Und wenn sie minimal steigt, dann nicht schneller als das Wirtschaftswachstum. Bisher haben wir nicht erlebt, dass die Kuchenstücke kleiner geworden sind.
Das Problem ist aber, dass die, die schon lange am Tisch sitzen, bemerken, dass die Kuchenstücke nicht größer werden. Aber alle bisherigen benachteiligten Gruppen, zuerst Frauen und dann zunehmend Migranten und andere, stellen mehr und mehr Forderungen. Berechtigterweise, denn sie sind immer noch benachteiligt. Eine Person, die schon lange am Tisch sitzt, stellt sich nun die Frage: Was wollen die denn noch? Und dann kommen Populisten und sagen, die wollen den ganzen Laden übernehmen. So werden schnell Ängste geschürt.
„Das Integrationsparadox“ ist 2018 erschienen und hatte viel Resonanz. Was hat sich seither getan?
Anfangs wurde meine These entweder als provokant oder als optimistisch bezeichnet. Interessant ist, dass seit 2020 in den Besprechungen das „provokant“ weggefallen ist. Provokant ist die These nicht mehr, weil wir das diffuse, ansteigende Konfliktpotenzial wahrnehmen, zum Beispiel durch das, was in Halle oder Hanau passiert ist, oder die Bewegungen, die entstanden sind, wie Black Lives Matter.
Und jetzt fällt auch das „optimistisch“ weg, denn 2018 klang das, was ich beschrieben habe, nicht wie die Realität, sondern nur wie mein Optimismus. Dem ist aber nicht so, das bemerkt man jetzt. Zum Beispiel sehen wir in Deutschland überall, beispielsweise im Fernsehen bei den Moderatoren oder in Start-Ups oder in der Wissenschaft, Menschen mit internationaler Geschichte. Und das wird in den nächsten Jahren – das kann man anhand der Daten vorhersehen – nochmal deutlich zunehmen. In Deutschland sagt niemand mehr: Wir brauchen Vorbilder. Die Vorbilder sind jetzt da.
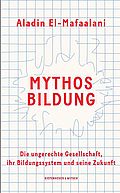
Aladin El-Mafaalani
Mythos Bildung - Die ungerechte Gesellschaft, ihr Bildungssystem und seine Zukunft
Kiepenheuer & Witsch, 2020
Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo



