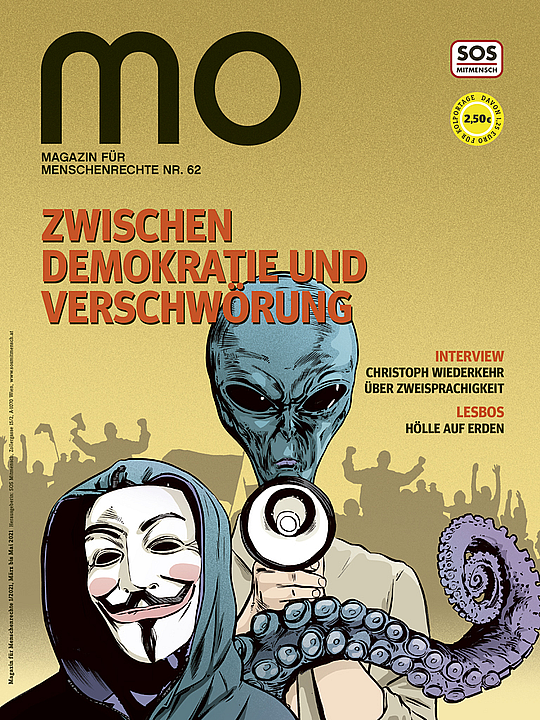Parlamentarische Kontrolle
Ein professioneller Verfassungsschutz braucht eine saubere politische Steuerung. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Polizei-Kolumne: Philipp Sonderegger
Das BVT kommt nicht aus den Schlagzeilen. Vor dem Sommer soll eine Reform den Malversationen ein Ende setzen. Bereits auf Schiene sind eine kriteriengeleitete Personalauswahl und strengere Überprüfungen der Mitarbeiter*innen. Ob die Pläne die Kuh vom Eis bringen ist fraglich. So lange Parteipolitik im Verfassungsschutz jenen Nährboden findet, der im BVT-Untersuchungsausschuss zu Tage trat, ist jeder Fleiß vergebens.
Gegen allzu plumpen Politeinfluss hilft das Licht der Öffentlichkeit. Aber der Staatsschutz hat berechtigte Interessen der Geheimhaltung. In Österreich treten noch zwei Spezifika hinzu: das BVT ist sehr polizeilich geprägt, es fehlt die bürokratische Hochkultur der Polizeijurist*innen, wie sie in den Landespolizeidirektionen noch gedeiht. Gleichzeitig ist die demokratische Kontrolle auf den Minister verengt. Die Abgeordneten im Stapo-Ausschuss können froh sein, wenn sie Allgemeines erfahren.
Mehr Kontrolle würde das BVT in der Erfüllung des gesetzlichen Auftrags stärken und vor Interferenzen mit sachfremdem Kalkül abschirmen. Soll die Aufsicht erfolgreich sein, nimmt sie Output und Input der Organisation in den Blick. Das heißt, sie kontrolliert einerseits, ob im Amt wirksam, ethisch angemessen und rechtmäßig agiert wird. Andererseits nimmt sie sich der Frage an, um welche Phänomene sich der Verfassungsschutz überhaupt kümmert. Also wie viel Ressourcen in die Überwachung von zum Beispiel Tierrechtsaktivist*innen gehen und wie viel in die von Syrienrückkehrern.
Die politische Input-Steuerung ist insbesondere beim Nachrichtendienst zentral. Das Betätigungsfeld des polizeilichen Staatsschutzes ist durch Sicherheitspolizeigesetz und Strafgesetzbuch konkret festgelegt und er wird dabei durch die unabhängige Justiz kontrolliert (sieht man vom Rechtsschutzbeauftragten ab). Der Nachrichtendienst hat hingegen mit der erweiterten Gefahrenforschung praktisch freie Hand, wo er hinschaut. Und übt dabei beträchtliche Definitionsmacht über die Grenzen des demokratischen Spektrums aus. Diese Festlegung braucht eine breitere Legitimation als bloß durch den Minister.
Philipp Sonderegger ist Menschenrechtler, lebt in Wien und bloggt auf phsblog.at.
Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo