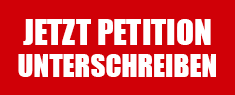Religionsfreiheit – Fragen & Antworten
Religionsfreiheit ist als Grundrecht in der österreichischen Verfassung festgeschrieben. Doch die politischen Rufe nach Einschränkungen werden immer lauter. Ist Religionsfreiheit heute nicht mehr von Bedeutung? SOS Mitmensch hat unter Einbeziehung von Stellungnahmen von ExpertInnen zwölf Fragen und Antworten zur Religionsfreiheit in Österreich zusammengestellt.
--> Fragen-und-Antworten-Papier zu Religionsfreiheit zum Herunterladen
|
Welche im Parlament vertretenen Parteien wollen die Freiheit der individuellen Religionsausübung in Österreich einschränken? |
|
Das verfassungsmäßige Recht auf Religionsfreiheit ist kein unumschränktes Recht. Die Religionsfreiheit kann etwa dort beschränkt werden, wo ihre Ausübung die öffentliche Ordnung oder öffentliche Sicherheit gefährdet (für Details siehe die Frage 9: „Wodurch kann Religionsfreiheit eingeschränkt werden?“). Doch die Religionsfreiheit genießt durch die Verankerung in der österreichischen Verfassung einen besonders hohen rechtsstaatlichen Schutz.
In den vergangenen Jahren wurden immer wieder von Parteien, die im Parlament vertreten sind, Einschränkungen der Freiheit der individuellen Religionsausübung gefordert und teilweise auch beschlossen. Zumindest ein Teil dieser geforderten oder beschlossenen Einschränkungen würde, laut Ansicht von ExpertInnen, gegen das verfassungsmäßige Recht auf Religionsfreiheit verstoßen.
Gesetzlich beschlossen wurde ein Verbot des Tragens des Gesichtsschleiers im öffentlichen Raum und in öffentlichen Einrichtungen (SPÖ, ÖVP und FPÖ). Außerdem wurde im November 2018 das „Kopftuchverbot für Kindergartenkinder“ (ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS, JETZT) sowie im Mai 2019 das „Kopftuchverbot für Volksschülerinnen“ erlassen (ÖVP und FPÖ). Gefordert wurde darüber hinaus ein Verbot des Tragens sichtbarer religiöser Erkennungsmerkmale in einigen Bereichen des öffentlichen Dienstes, wie dem Polizeidienst und dem RichterInnendienst (SPÖ und ÖVP) und der LehrerInnentätigkeit (ÖVP und FPÖ). Gefordert wurden des Weiteren ein totales Tschadorverbot (FPÖ) sowie totale Kopftuchverbote an Schulen und Universitäten (FPÖ), in öffentlichen Gebäuden (FPÖ) und auf der Straße (FPÖ). Des Weiteren wurde die Schließung aller islamischen Kindergärten (ÖVP und FPÖ) und Schulen (FPÖ) gefordert. Es wurde ein totales Verbot der Schächtung gefordert (FPÖ). Und es wurde ein Verbot der Beschneidung von Kindern gefordert (FPÖ).
Ein Großteil der geforderten Einschränkungen würde insbesondere religiöse MuslimInnen – und hier ganz besonders Frauen, die Kopftuch tragen – treffen. Besonders stark betroffen wären auch religiöse Jüdinnen und Juden. Betroffen von der Umsetzung der geforderten Einschränkungen wären darüber hinaus auch Angehörige anderer religiöser Glaubensgemeinschaften zu deren Religionspraxis das Tragen bestimmter Kleidungsstücke zählt. |
|
Warum ist Religionsfreiheit so wichtig, dass sie in der Verfassung festgeschrieben ist? |
|
Der Verfassungsjurist Theo Öhlinger erklärt: „Die Religionsfreiheit steht am Beginn der Idee der Menschenrechte. Mit ihr endeten die grausamen Verfolgungen von Andersgläubigen in Europa (die dem heutigen IS in nichts nachstanden). Sie ist Voraussetzung dafür, dass ein Mensch sein Leben nach seinen innersten Überzeugungen gestalten darf. Nur ein Staat, der diesen Freiraum des Einzelnen akzeptiert – dazu gehört selbstverständlich auch das Recht, keine religiöse Überzeugung zu haben –, ermöglicht die freie geistig-seelische Entfaltung des Individuums. Religionsfreiheit setzt nicht nur Toleranz des Staates, sondern auch wechselseitige Toleranz der Menschen voraus. Darin findet die Religionsfreiheit ihre Grenzen. Ein Fundamentalismus, der andere Anschauungen nicht akzeptiert und respektiert, wird durch das Grundrecht aller Menschen auf Religionsfreiheit nicht mehr verfassungsrechtlich geschützt. Insofern erlaubt die Religionsfreiheit gesetzliche Beschränkungen, soweit sie – in der Terminologie der EMRK - “in einer demokratischen Gesellschaft notwendige Maßnahmen im Interesse der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, Gesundheit und Moral oder für den Schutz der Rechte und Freiheiten anderer sind.” Kurz gesagt: Einschränkungen der Religionsfreiheit müssen verhältnismäßig sein.“
Der Historiker Karl Vocelka schreibt: „Religionsfreiheit ist ein wesentlicher Teil der Menschenrechte, die sich seit dem 18. Jahrhundert entwickelten. Die Aufnahme in der Verfassung ist in Österreich nicht zuletzt deshalb wichtig, weil vom beginnenden 17. bis zum 18. Jahrhundert in der Zeit der Gegenreformation, keine konfessionelle Toleranz herrschte, die sich erst – beginnend mit Joseph II. – langsam durchsetzte. Wenn in einem Staat keine Religionsfreiheit garantiert wäre, würde ein wesentlicher Bestandteil der Menschenrechte fehlen. Auch für Menschen wie mich, die keiner Konfession angehören und atheistisch sind, ist Religionsfreiheit damit ein wesentlicher Punkt unseres Verständnisses von Freiheit.“ |
|
Was bedeutet die Festschreibung der Religionsfreiheit in der Verfassung konkret? |
|
Eine Verfassung enthält grundlegende Richtlinien über die Staats- und Regierungsform, den Aufbau des Staates und die Stellung und Rechte der Menschen, die in diesem Staat leben. In der Verfassung verankerte Rechte, die einzelne Personen schützen, gelten als Grundrechte. Sie sollen vor Eingriffen des Staates in individuelle private Angelegenheiten schützen. Manche dieser Rechte stehen in Österreich ausschließlich StaatsbürgerInnen zu (z.B. Gleichheit vor dem Gesetz), andere gelten für „Jedermann“.
Neben dem Recht auf Leben, dem Verbot von Folter, dem Gleichheitssatz und der Meinungsfreiheit ist auch die Religionsfreiheit als ein Grundrecht in der Verfassung festgeschrieben.
Dieses Grundrecht ist, wie andere Grundrechte auch, vor willkürlichen Änderungen geschützt. Um eine Verfassungsbestimmung neu zu regeln oder aufzuheben, bedarf es einer Zustimmung von mindestens zwei Drittel der Abgeordneten im Nationalrat. Bei grundlegenden Änderungen der Verfassung ist überdies eine Volksabstimmung verpflichtend durchzuführen.
Die Religions- bzw. Glaubensfreiheit ist in mehreren Artikeln des im Verfassungsrang befindlichen Staatsgrundgesetzes von 1867 festgeschrieben:
Der Staat trägt durch diese Paragraphen eine ,,Schutzpflicht‘‘, unabhängig davon, ob es sich um eine von der Mehrheit der Bevölkerung praktizierte Religion handelt, oder um eine religiöse Minderheit. Der Staat steht nicht nur in der Verantwortung, die Religionsfreiheit aller im Staat lebenden Menschen zu achten, sondern auch gegen Angriffe seitens Dritter zu schützen.
Während die oben genannten Verfassungsartikel Religionsfreiheit konkret beschreiben, wirken darüber hinaus andere Grundrechte auf die freie Auslebung und Ausübung verschiedener Glaubensrichtungen ein, etwa die Unterrichtsfreiheit, das Recht auf Bildung, die Kommunikationsfreiheit, und auch die Meinungsfreiheit.
Wichtig: Die Religionsfreiheit schützt nicht nur die Ausübung von Religion, sondern sie schützt auch vor dem Zwang zu einem religiösen Bekenntnis. Es werden also ebenso atheistische und agnostische Weltanschauungen vor Eingriffen geschützt. Religionsfreiheit bedeutet in diesem Zusammenhang also nicht bloß den Schutz der Religion, sondern auch den Schutz vor Religion.
Die Festschreibung der Religionsfreiheit in der Verfassung erhebt sie zu einem besonders schützenswerten Recht, welches nicht willkürlich oder unbedacht verändert oder aufgehoben werden kann. Die Freiheit der Religionen und die Freiheit der Religionslosigkeit als Grundrecht zu verankern, macht dieses Grundrecht zu einem grundlegenden Prinzip des österreichischen Staates. |
|
Wer profitiert vom Schutz der Religionsfreiheit? |
|
Angehörige religiöser Mehrheiten und Minderheiten Die Religionsfreiheit garantiert die freie Religionsausübung im Einklang mit der öffentlichen Ordnung und öffentlichen Sicherheit und in Abwägung zu anderen Grundrechten. Mitglieder unterschiedlicher religiöser Gruppen sind damit in vielen Bereichen vor staatlichen Eingriffen und Diskriminierung geschützt. Dies betrifft sowohl Angehörige einer religiösen Mehrheit, als auch Angehörige von Minderheiten.
Glaubensgemeinschaften Die Religionsfreiheit beinhaltet, dass es grundsätzlich jeder religiösen Gruppe offensteht, sich als staatlich eingetragene Bekenntnisgemeinschaft konstituieren zu lassen, sofern der Schutz öffentlicher Interessen durch eine bestimme Anschauung nicht gefährdet wird. Für die gesetzliche Anerkennung von Religionsgemeinschaften müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden (u.a. gesicherter Bestand, Mindestanzahl von Angehörigen). Auch Religionsgemeinschaften genießen in vielen Bereichen Schutz vor staatlichem Zwang und Diskriminierung.
Nichtreligiöse Menschen Die Religionsfreiheit schützt auch nichtreligiöse Menschen. Die Vorschreibung oder der Zwang zu einem religiösen Bekenntnis sind verboten. Menschen haben das Recht, sich zu keiner Religion zu bekennen und konfessionslos zu leben. Es werden also ebenso atheistische und agnostische Weltanschauungen durch die Glaubens- und Gewissensfreiheit vor Eingriffen geschützt. Religionsfreiheit bedeutet in diesem Zusammenhang also nicht bloß den Schutz der Religion, sondern auch den Schutz vor Religion. |
|
Welche Rechte und Pflichten bringt die Religionsfreiheit? |
|
Den in Österreich lebenden Menschen wird durch die verfassungsrechtliche Verankerung der Religionsfreiheit garantiert, das Bekenntnis oder Nichtbekenntnis zu einer Religion frei von staatlichem Zwang zu leben, und sich diesem Bekenntnis oder Nichtbekenntnis nach in religiöser Hinsicht betätigen zu dürfen. Niemand darf zur Offenlegung seines oder ihres Glaubens gezwungen werden.
Eltern wird das Recht zugestanden, ihre Kinder in dem von ihnen gelebten Glaubensbekenntnis zu erziehen, bis die Kinder das Alter der Religionsmündigkeit erreicht haben, welches in Österreich bei 14 Jahren liegt.
Die Proklamation der Religionsfreiheit fordert im Gegenzug einen sensiblen und besonnenen Umgang mit den Prinzipien eines demokratischen Staates von allen Mitgliedern religiöser und nichtreligiöser Gruppierungen. Es besteht die Verpflichtung, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu respektieren.
Das demokratische Prinzip, das republikanische Prinzip und das rechtsstaatliche Prinzip der österreichischen Verfassung beinhalten die Verpflichtung, dass keine Religion ihre religiösen Haltungen über die Rechtshoheit des Staates stellt. |
|
Wodurch kann Religionsfreiheit eingeschränkt werden? |
|
Für alle Grundrechte gilt ein ,,Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“. Das bedeutet, dass der Gesetzgeber Regelungen, welche die Grundrechte betreffen, gegeneinander abwägen muss, sodass die Einforderung eines Grundrechts nicht gleichzeitig ein anderes Grundrecht beschränkt.
Ein Grundrecht wie die Religionsfreiheit kann daher nicht als absolutes Ganzes betrachtet werden, sondern muss stets mit anderen Grundrechten in Bezug gesetzt werden.
Auf nationaler und internationaler Ebene werden manche Aspekte der Religionsfreiheit, die Ausübung gewisser Praktiken, etwa unter Bezugnahme auf Frauen- und Kinderrechte diskutiert.
Im staatlichen Rahmen kann das Recht auf Religionsfreiheit beschränkt werden, sofern die öffentliche Ordnung oder öffentliche Sicherheit als gefährdet erachtet wird: „Alle Einwohner Österreichs haben das Recht, öffentlich oder privat jede Art Glauben, Religion oder Bekenntnis frei zu üben, sofern deren Übung nicht mit der öffentlichen Ordnung oder mit den guten Sitten unvereinbar ist.“ Mit der „öffentlichen Ordnung“ unvereinbar sind laut Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs „nur Handlungen, die das Zusammenleben der Menschen im Staate empfindlich stören“.
Die Europäische Menschenrechtskonvention erlaubt ebenfalls eine Einschränkung der Religionsfreiheit, sofern dies „zum Schutz der Interessen der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, Gesundheit und Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist.“
Ein oftmals diskutiertes Beispiel, in dem veranschaulicht werden kann, dass das Verständnis, was als Einschnitt in öffentliche Ordnungen gelten kann, gesellschaftlich nicht zwingend konsensual ist, stellt das Verbot der Gesichtsverschleierung dar. Ob dieses mit 1. Oktober 2017 in Kraft befindliche vollständige Gesichtsverschleierungsverbot im öffentlichen Raum in Österreich verfassungskonform ist, wurde noch nicht ausjudiziert. Ausjudiziert wurde jedoch, ob das Verbot eine Verletzung der Religionsfreiheit gemäß der Europäischen Menschenrechtskonvention darstellt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) prüfte den Sachverhalt, als Belgien und Frankreich 2010/11 ein solches Gesetz einführten. Es wurde unter anderem die Begründung angeführt, dass eine Vollverschleierung die Identifizierung der Trägerinnen unmöglich machen würde, was mit den staatlichen Sitten (etwa in Bezug auf Kommunikation) nicht vereinbar sei und möglicherweise auch ein Sicherheitsrisiko darstellen würde. Es wurde in diesem Zusammenhang vom EGMR keine Verletzung der Menschenrechtskonvention in Bezug auf Religionsfreiheit festgestellt. Im Juli 2017 reagierte der EGMR auf eine Klage von zwei belgischen Gesichtsschleierträgerinnen und erklärte das in Belgien geltende Verbot der Vollverschleierung für rechtmäßig. Ein solches Verbot sei „für eine demokratische Gesellschaft notwendig“. |
|
Schützt die Festschreibung der Religionsfreiheit in der Verfassung auch religiösen Fundamentalismus? |
|
Die in der Verfassung verankerten Regelungen sollen ein friedliches Zusammenleben der Menschen innerhalb eines Staates sichern. Zu diesem Zwecke wird der freien Ausübung von Religionen und der freien Entfaltung von Meinungen und Weltanschauungen ein großer Spielraum eingeräumt, der auch von Extremisten und Fundamentalisten in gewissem Ausmaß ausgenutzt werden kann. Dieser Spielraum ist jedoch nicht unbeschränkt. Grundrechte, wie die Religionsfreiheit, wirken nur im Verhältnis zu anderen verfassungsrechtlichen Grundrechten. Sind diese Grundrechte – wie etwas das Recht auf Leben, die Meinungsfreiheit, das Verbot von Folter, die persönliche Freiheit, etc. – durch extremistische und fundamentalistische Haltungen bedroht, so kann und muss der Staat eingreifen. Darüber hinaus kann und muss der Staat überall dort eingreifen, wo die öffentliche Ordnung oder öffentliche Sicherheit als gefährdet erachtet wird (siehe dazu auch Frage 9: „Wodurch kann Religionsfreiheit eingeschränkt werden?“). |
|
Wohin könnte es führen, wenn der Schutz von Religions- und Gewissensfreiheit nicht mehr in der Verfassung festgeschrieben wäre? |
|
Ohne Religionsfreiheit im Verfassungsrang könnten Einschränkungen der Religionsfreiheit wesentlich leichter umgesetzt werden. Mittels einfacher parlamentarischer Mehrheit könnte die Freiheit der Ausübung von Religionen beschränkt werden, ebenso die Freiheit der Religionslosigkeit.
Dadurch könnte insbesondere der Schutz von (religiösen oder nichtreligiösen) Minderheiten durchlöchert werden, und der Weg für Diskriminierung durch eine (parlamentarische repräsentierte) Mehrheit würde geebnet.
Religiöse und/oder nichtreligiöse Minderheiten könnten durch diskriminierende Bestimmungen an den Rand der Gesellschaft gedrängt und kriminalisiert werden. Es käme dadurch zu einer Benachteiligung und Entfremdung der betroffenen Minderheiten.
Eine solche Entwicklung der Aufhebung und Unterdrückung von Religionsfreiheit wäre wohl mit massiven Spannungen, Konflikten und sowohl staatlicher Gewalt – im Extremfall bis hin zur Inhaftierung, Vertreibung und Verfolgung von religiösen Minderheiten – als auch möglicher Gegengewalt verbunden. |
|
Seit wann ist Religionsfreiheit rechtlich in Österreich verankert? |
|
Das Thema Religionsfreiheit trägt eine lange Geschichte, die hier nicht in vollem Ausmaß wiedergegeben werden kann, darum werden nur einige wichtige Punkte genannt:
|
|
In welchen Verträgen und Beschlüssen wird die Religionsfreiheit noch geschützt? |
|
Einzelne Aspekte der Religionsfreiheit werden in unterschiedlichen internationalen Verträgen thematisiert. Im Folgenden sollen grundlegende Beschlüsse angeführt werden, die als prägend für die österreichische Verfassung, bzw. für das Selbstverständnis des österreichischen Staates bezeichnet werden können:
Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte Nach dem 2. Weltkrieg, wurde eine Kommission gegründet, um einen internationalen Menschenrechtskodex zu entwickeln – die allgemeine unverbindliche Erklärung der Menschenrechte. Diese Erklärung wurde am 10. Dezember 1948 verabschiedet. Der Artikel 18 dieser Erklärung betrifft die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, ohne staatlichen Zwang, im privaten und im öffentlichen Raum. Dieses Menschenrecht wurde auch in Artikel 18 des UN-Zivilpaktes aufgenommen, ausgeformt und verbindlich definiert.
Kinderrechtskonvention Die Kinderrechtskonvention schützt die religiöse Kindererziehung – die Freiheit der Eltern muss geachtet werden, die religiöse und sittliche Erziehung ihrer Kinder in Übereinstimmung mit ihren eigenen Überzeugungen sicherzustellen – solange Kinder sich in Fragen der Religion keine eigene Meinung bilden können. Bei älteren Kindern muss deren Meinung berücksichtigt werden. Das Alter für Religionsmündigkeit beträgt in Österreich 14 Jahre.
Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention Der Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert Gedanken-, Gewissens-, und Religionsfreiheit. Der Artikel beinhaltet auch die Garantie, das Religionsbekenntnis ändern und den Glauben ohne Überwachung ausleben zu dürfen. Die Europäische Menschenrechtskonvention wurde im Jahr 1958 durch ein Bundesverfassungsgesetz in Österreich in den Verfassungsrang gehoben. Der 1. Abschnitt der Europäischen Menschenrechtskonvention, in welchem die Grundrechte der europäischen Bürgerinnen und Bürger, etwa auch die Gedanken-, Gewissens-, und Religionsfreiheit, verankert sind, wird unmittelbar umgesetzt.
Artikel 10 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union Auch in Artikel 10 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union werden die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit festgehalten. Dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder privat durch Gottesdienst, Unterricht, Bräuche und Riten zu bekennen. In Verfahren, in denen Unionsrecht umgesetzt wird, steht die Charta auf einer Ebene mit der österreichischen Verfassung. |
|
Soll die Mehrheit uneingeschränkt über das Leben von Minderheiten entscheiden können? |
|
Nicht nur die Vergangenheit lehrt, wohin die Diskriminierung von Minderheiten durch die Mehrheit führen kann. Auch auf heutigen nationalen und internationalen Ebenen kommt es durch die Unterdrückung von Minderheiten und Einschnitten in ihr Selbstbestimmungsrecht immer wieder zu Krisen und Konflikten.
Vor allem seit den 1990er Jahren, im Zuge der Konflikte im nun ehemaligen Jugoslawien, wurde die Bedeutung von Minderheitenrechten auch für Österreich besonders präsent. Österreich war es auch, das 1992 eine Erklärung über die Rechte von Personen, die nationalen, ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, in der Generalversammlung der Vereinten Nationen einbrachte.
Das Recht von Minderheiten auf Schutz und Selbstbestimmung, sowie das Verbot von Diskriminierung dieser Gruppen durch die Mehrheitsgesellschaft ist in verschiedenen menschenrechtlichen Verträgen festgeschrieben (Erklärung der Menschenrechte, Europäische Menschenrechtskonvention, Gleichbehandlungsgesetz).
Durch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 wurden die Rechte eines jeden Menschen als Individuum definiert, weshalb jedem Menschen die gleichen Rechte zugestanden werden sollen, unabhängig davon, ob sie Mitglied der Mehrheit oder einer Minderheit innerhalb eines Staates sind.
Die österreichische Verfassung setzt Mehrheitsentscheiden über das Leben von Minderheiten Schranken. Zur Änderung der Verfassung bedarf es der Zustimmung von zwei Drittel der Abgeordneten. Eine grundlegende Verfassungsänderung bedarf darüber hinaus einer Volksabstimmung.
Der Respekt und Schutz gegenüber Minderheiten stellt ein wichtiges Prinzip demokratischer Gesellschaften dar. Die Wertschätzung von Vielfältigkeit und Pluralismus in allen Bereichen der Gesellschaft wird als Zeichen von Demokratien herangezogen, und oftmals als signifikanter Unterschied zu repressiven Staatsformen angeführt.
Sprachliche, ethnische, sexuelle oder religiöse Minderheiten erfahren jedoch auch in demokratischen Staaten oftmals erhebliche Schwierigkeiten. Trotz rechtlichem Schutz können strukturelle Benachteiligungen und Diskriminierungen, sowie ein ablehnendes Gesellschaftsklima auftreten und sich belastend auf Minderheitenangehörige und das Zusammenleben auswirken.
Akzeptanz und Pluralität dürfen daher nicht bloß proklamierte Schlagworte sein, es bedarf dazu kontinuierlicher Arbeit. |
|
Ist Österreich ein säkularer Staat? |
|
Der österreichische Staat bekennt sich in Bezug auf Religion und Religionsfreiheit (aber nicht bloß dort) zu verschiedenen Prinzipien:
Der österreichische Staat basiert also auf einer weitgehenden – aber nicht in allen Bereichen durchgehenden – Trennung von Kirche(n) und Staat. Diese Trennung sichert das demokratische, das republikanische und das rechtsstaatliche Prinzip in Österreich. Darüber hinaus verhindert diese Trennung eine einseitige Bevorzugung oder Diskriminierung von anerkannten Religionen. Des Weiteren wird auch die Möglichkeit geschützt, sich für ein Leben ohne Religion oder Konfession zu entscheiden.
Der Säkularismus Österreichs unterscheidet sich von laizistischen Staatsmodell, wie etwa jenem in Frankreich, wo eine wesentlich striktere Trennung von Staat und Religion gegeben ist. Laizismus beschreibt die neutrale Position einer Regierung bezüglich der Religion ihrer Bürger. Säkulare Staaten, wie etwa Österreich, definieren sich zwar ebenso als religiös und weltanschaulich neutral, haben diese Trennung jedoch nicht umfassend umgesetzt (Kirchensteuer, Verträge mit großen Kirchen, Religionsgemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts, etc.).
Es kann auch nicht ignoriert werden, dass die religionsbezogene geschichtliche Entwicklung eines Landes Auswirkungen auf den praktischen Umgang mit der Gleichstellung von Religionen hat. Während sich Österreich als säkular proklamiert, werden Diskussionen und Entscheidungen, auch auf politischer Ebene, oftmals von religiösen Traditionen und Strukturen beeinflusst. Österreich ist historisch von der privilegierten Stellung der römisch-katholischen Kirche geprägt.
Trotz des Verlusts der Einflussnahme des Katholizismus auf staatlicher Ebene, wird eine Bevorzugung ,,christlicher Werte‘‘ und Symbole umgesetzt, wodurch die Gefahr einer strukturellen Diskriminierung anderer Religionen besteht. Dies lässt sich etwa anhand der Diskussion um das Kreuz in öffentlichen Gebäuden und in Gerichtssälen demonstrieren. Auch breite gesellschaftliche Debatten, etwa über Sexualerziehung, die Rechte von Menschen mit LGBTIQ-Identitäten (z.B.: gleichgeschlechtliche Ehe) oder das Thema Abtreibung, werden nicht selten mit religiösen Argumenten aufgeladen und/oder von religiösen Einrichtungen mitbetrieben. |
Jetzt den SOS Mitmensch Newsletter abonnieren
Ermöglichen Sie mit einer Spende unsere weitere Menschenrechtsarbeit