
Juristin Rössl: „Wahlrechtsausschluss bedeutet Verzerrung der politischen Willensbildung"
Die am Juridicum der Uni Wien tätige Rechtswissenschafterin Mag.a Ines Rössl spricht angesichts des Wahlrechtsausschlusses von 1,4 Millionen Menschen von einer Verzerrung der politischen Willensbildung. Besonders benachteiligt sind ökonomisch marginalisierte Personen. Im Folgenden ihr Statement zur Pass Egal Wahl von SOS Mitmensch:
Problem für die Demokratie
„Nur wer die österreichische Staatsbürgerschaft hat, darf mitbestimmen, wer Bundespräsident*in wird. Das hat zur Folge: Rund 1,4 Millionen Menschen im Wahlalter sind von der Bundespräsidentschaftswahl ausgeschlossen, weil sie nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. In Wien ist ein Drittel der Wohnbevölkerung im Wahlalter nicht stimmberechtigt. Der Vergleich mit vergangenen Wahlen zeigt: Der Anteil jener Personen, die hier leben, aber nicht wählen dürfen, steigt. Das ist ein Problem für die Demokratie. Der Wahlrechtsausschluss betrifft auch Menschen, die seit vielen Jahren hier leben, allenfalls sogar hier geboren sind. Laut Statistik Austria leben etwa 40 % aller ausländischen Staatsangehörigen bereits seit mindestens 10 Jahren in Österreich, rund weitere 25 % seit mindestens 5 Jahren.
Ökonomische Hürden
Einerseits muss die Frage diskutiert werden, ob die Möglichkeit der politischen Mitbestimmung wirklich an die Staatsbürgerschaft geknüpft sein soll. Andererseits liegt das Problem im österreichischen Staatsbürgerschaftsrecht. Der Zugang zur Staatsbürgerschaft ist in Österreich im internationalen Vergleich besonders restriktiv. Es muss nicht nur eine bestimmte Aufenthaltsdauer (in der Regel 10 Jahre) erfüllt sein. Sondern die Einbürgerung ist an zahlreiche zusätzliche Bedingungen geknüpft. Auch wenn jemand mehr als 10 Jahre hier lebt, auch wenn jemand hier geboren ist – diese Bedingungen müssen immer erfüllt sein. Zu diesen Bedingungen zählt ein bestimmtes Mindesteinkommen. Dieses stellt eine besondere Hürde dar und schließt marginalisierte Personengruppen vom Zugang zur Staatsbürgerschaft aus.
Menschen müssen über einen gewissen Zeitraum hindurch bestimmte Einkommensgrenzen erreichen und dürfen keine Sozialhilfeleistungen (wie etwa Mindestsicherung) beziehen, damit ihnen die Staatsbürgerschaft verliehen werden kann. Die monatlichen Netto-Einkommensgrenzen betragen für das Jahr 2022 rund 1.000 Euro für Einzelpersonen und rund 1.600 Euro für Ehepartner*innen und eingetragene Partner*innen. Für jedes Kind müssen rund weitere 160 Euro nachgewiesen werden. Und regelmäßige Kosten (wie z.B. Miete oder Heizkosten) erhöhen die notwendigen Einkünfte zusätzlich. Für viele Menschen bedeuten diese Anforderungen an das monatliche Netto-Einkommen eine unüberwindbare Hürde, die Staatsbürgerschaft erlangen zu können.
Wenn man bedenkt, dass Frauen im Durchschnitt weniger verdienen als Männer, dann wird außerdem deutlich, dass die Einkommenshürden diskriminierende Effekte für Frauen haben. Frauen tun sich im Durchschnitt noch schwerer, die notwendigen Netto-Einkommen nachzuweisen.
Einkommen als Bedingung für politische Zugehörigkeit?
Der Zugang zur Staatsbürgerschaft ist also verwehrt, wenn man zu wenig verdient. Ist das legitim? Warum soll das Einkommen darüber entscheiden, ob eine Person als zugehörig zu einem politischen Gemeinwesen gelten soll? Denn darum geht es: Um Zugehörigkeit. Die Staatsbürgerschaft ist der juristische Ausdruck für politische Zugehörigkeit. Deshalb ist sie traditionellerweise auch so eng mit dem Wahlrecht verknüpft. Warum aber soll das Einkommen darüber entscheiden, wer über die Geschicke eines Landes mitbestimmen darf?
Das demokratische Ideal bedeutet, dass sich Menschen die Regeln des Zusammenlebens selbst geben und dass sie den politischen und ökonomischen Kräften, die auf sie einwirken, nicht ohnmächtig ausgeliefert sind. Wer aber nicht mitbestimmen darf, über den wird bestimmt. Eine steigende Gruppe von Menschen, die ihr Leben von vornherein als fremdbestimmt begreifen muss, ist ein Problem für die Demokratie.
Verzerrung der Willensbildung
Außerdem bedeutet der Wahlrechtsausschluss eine Verzerrung der politischen Willensbildung. Und zwar auf mehreren Ebenen. Nicht nur sind jene nicht repräsentiert, die seit langem hier leben, aber die ökonomischen Voraussetzungen für die Staatsbürgerschaft nicht erfüllen. Sondern der Wahlrechtsausschluss der Nicht-Staatsbürger*innen hat auch Auswirkungen auf die Interessensvertretung der Staatsbürger*innen. Man kann annehmen, dass Menschen, die bestimmte soziale und ökonomische Lebenslagen teilen, in vieler Hinsicht gemeinsame Interessen haben. Diese gemeinsamen Interessen, zum Beispiel an arbeits- und sozialrechtlichen Standards, sind unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Ein Staatsbürgerschaftsrecht, das ökonomisch schlechter gestellte Personen von der Einbürgerung und damit vom Wahlrecht ausschließt, schwächt die politische Vertretung der Interessen all jener, die nicht so viel haben – ganz unabhängig davon, woher sie oder ihre Eltern kommen. Das restriktive Staatsbürgerschaftsrecht führt dazu, dass die Interessen ökonomisch marginalisierter Personen politisch unterrepräsentiert sind. Auch das ist ein demokratiepolitisches Problem. Und es zeigt, dass der Wahlrechtsausschluss ein Problem ist, das alle angeht – unabhängig von der Staatsbürgerschaft."
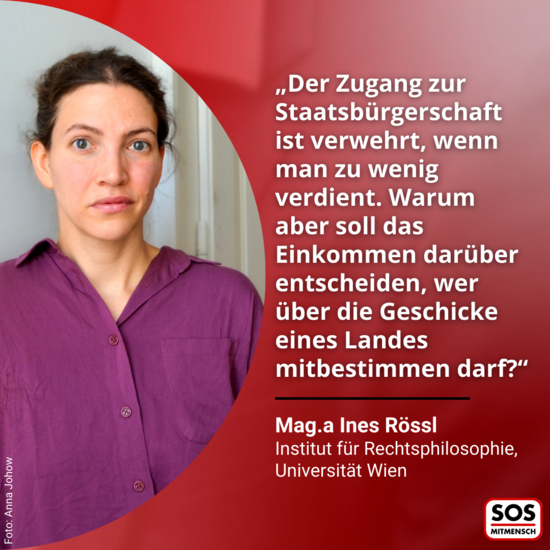
Jetzt den SOS Mitmensch Newsletter abonnieren
Ermöglichen Sie mit einer Spende unsere weitere Menschenrechtsarbeit


