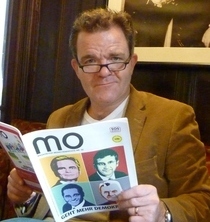„Unser Fokus ist ein humanitärer“
Im Ankunftszentrum am Rand des Wiener Praters werden die Neuankömmlinge aus der Ukraine versorgt. Die Idee dafür hatte der 2015 gegründete Verein „Train of Hope“. Aufgrund von Versorgungsmängel kehren aber viele Menschen noch Wochen später dorthin zurück. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Text: Gunnar Landgesell, Fotos: Karin Wasner
Anna, eine Frau mittleren Alters, und ihre Freundin sind gerade aus Ungarn im „Humanitären Ankunftszentrum“ in Wien mit ihren Kindern und dem wenigen Gepäck angekommen, das man auf der Flucht so mitnehmen kann. Anna hat zwei Kinder, 10 und 20 Jahre alt, nun sind die zwei Restfamilien am Rand des Wiener Praters gestrandet. Seit Anfang März haben sie in Unterkünften in Ungarn ausgeharrt, vertrieben aus Dnipro, wo die Ehemänner ihnen mittlerweile mehrfach von Bombenangriffen berichten mussten. Im März wurde in der Stadt an dem gleichnamigen Fluss u.a. auch ein Kindergarten getroffen, im April der Flughafen schwer beschädigt. Die beiden Frauen wirken müde und positiv gestimmt, aber es ist zu merken, wie viel an Selbstdisziplin es dafür braucht. Nun sind sie hier in Wien, weil ihnen Bekannte berichtet haben, dass die Situation in Österreich besser sei als in Ungarn. Eigentlich wollten die beiden Frauen vor wenigen Tagen endlich wieder zurück in die Ukraine, als die russische Armee die Stadt erneut aus der Luft angriff. Jeden Tag denken sie an die Rückkehr, sagt die Frau, das fühle sich nun schon sehr lange an. Wo sie heute übernachten werden, wissen sie nicht.

Manuela Ertl und Nina Andresen von „Train of Hope“: Sie koordinieren die vielfältigen Anforderungen und Hilfsleistungen in der Halle mit Übersicht und Engagment.
Um 17 Uhr werde ein Bus kommen und sie in eine Unterkunft bringen, vielleicht in Wien, vielleicht woanders. Auf dem Tisch liegen ein paar Blätter Papier, die Registrierung, und eine Nummer, die ihnen zugewiesen wurde. Die kleine Gruppe hat gerade gegessen, sie wurde gut versorgt hier im Ankunftszentrum. Es ist eine kurze Pause in einem Dauerzustand der Unrast und Ungewissheit, die über Wochen immer neue Gesichter annimmt, aber nicht aufzuhören scheint. Einen Tisch weiter kämpft eine junge Frau, die gerade telefoniert, mit den Tränen. Sie wirkte Minuten zuvor noch gelassen und war für ein Gespräch bereit, als ihre Mutter ihre Unterstützung brauchte. Was genau passiert ist, eine schlimme Nachricht von zuhause, oder eine weitere Unwägbarkeit vor Ort – was die Menschen auf der Flucht an Belastungen erleben, ist für Außenstehende kaum nachvollziehbar. Das Ankunftszentrum spielt in solchen Situationen eine wichtige Rolle: als Ort auf der Reise, der etwas Halt geben soll. Signale an die Menschen, man sei wo angekommen und gut aufgehoben sind Teil des Konzepts. Bemerkenswert, dass die Idee dieses Ankunftszentrums in der ehemaligen Sport&Fun-Halle auf eine private Initiative zurückgeht. „Train of Hope“, 2015 im Zuge der großen Flüchtlingsankunft von Manuela Ertl und einer Gruppe von Aktivist*innen gegründet, half damals ebenso schnell wie improvisiert. Man stellte einen Tapeziertisch in der großen Halle des Hauptbahnhofs auf und machte sich an die Arbeit.
Bemerkenswert ist, dass sich die Helfer*innen nach erfolgreicher Arbeit nicht wieder zerstreuten, sondern einen Verein gründeten und begannen, eine Perspektive zu entwickeln – eigentlich schon eine nächste Krise antizipierend. Dass das die Ukraine und nicht etwa Afghanis tan betreffen würde, sagt Nina Andresen, die 2015 dazu stieß, hätten natürlich auch sie nicht erwartet. Doch wo der Krisenherd liegt, spielt keine so große Rolle. Hilfe braucht Organisation, Infrastruktur und Kompetenzen. Manuela Ertl und Nina Andresen sind heute im Wesentlichen für die Koordination von „Train of Hope“ zuständig. Man findet sie praktisch zu jeder Tages- und teils Nachtzeit auf der Seite der Mehrzweckhalle, wo in mehreren Containern Spenden der Bevölkerung gelagert und verteilt werden und die Logistik für das Ankunftszentrum samt Verpflegung und anderer Dienste koordiniert wird. Ertl und Andresen waren es auch, die, als der Ukraine-Krieg Ende Februar ausbrach, der Stadt Wien ein grobes Konzept für das Ankunftszentrum vorgeschlagen hatten. Andresen: „Unser Fokus ist ein humanitärer, deshalb wollten wir, dass die Ankunft in zwei Schritten organisiert ist: Im Ankunftszentrum sollen die Menschen nach einer strapaziösen Flucht versorgt werden, Informationen in der Erstsprache erhalten, sich duschen können, das Notwendigste erhalten. Der zweite Schritt sollte dann der bürokratische sein, dafür haben die Menschen, die eben erst angekommen sind, keinen Kopf. Da geht es um ganz andere, elementare Bedürfnisse, vor allem darum, Sicherheit zu vermitteln.“

Zur täglichen Essensausgabe und Verpflegung kommen nicht nur Erstankömmlinge, sondern auch viele Wiederkehrer. Das zeigt, dass die Versorgung der Geflüchteten nicht optimal funktioniert.
Wichtige Impulse
Es erstaunt, dass eine eigentlich kleine NGO als Impuls- und Ideengeberin in einer derart zentralen Rolle gefragt ist. Und dass diese konzeptuelle Arbeit nicht von der Kommune kommt. Andresen findet das aber durchaus naheliegend: „Wir verfügen über Erfahrung und sind sicherlich näher an den Menschen dran als eine Stadtverwaltung. Aber ich finde es nicht naheliegend, dass das eine NGO spendenfinanziert und ehrenamtlich macht.“ Dass es bis heute keine finanzielle Abgeltung für die Hilfsleistungen gibt, stimmt einen auch angesichts der Verantwortung, des Aufwandes und der psychosozialen Rolle, die die Ankunftsstelle hat, nachdenklich. Immerhin gibt es seit kurzem da- rüber Gespräche. Während ständig das Telefon läutet, sich Clowns für einen Einsatz in der Halle bereitmachen und Helfer*innen überlegen, wo sie gespendete Süßigkeiten, Babysachen und Hygieneartikel unterbringen, erzählt Manuela Ertl in einem der Container, wie sie der Kommune ihre Idee unterbreitet haben: „Wir haben das Konzept der MDOS vorgestellt, das ist die Magistratsdirektion für Organisation und Sicherheit, die für Krisenmanagement zuständig ist. Mit der MDOS hatten wir schon 2015 Kontakt, sie hat damals den Krisenstab der Stadt geleitet. Dort wurde alles besprochen, was es an Infrastruktur und Logistik braucht.“ Tatsächlich ist Train of Hope heute gemeinsam mit der Berufsrettung, die nicht im Sanitätsdienst vor Ort ist, sondern als Einsatzstab der Stadt Wien, gemeinsam für das Krisenmanagement verantwortlich. Was die finanzielle Absicherung des Projekts betrifft, war man 2015 acht Wochen nach Beginn der Erstversorgung mit den Gesprächen schon weiter. Damals war das Innenministerium zuständig, konkrete Verhandlungen liefen bereits. Ertl dazu: „Das ist doch überraschend, dass es 2015 mit dem Innenministerium schneller ging als es heute, wo die Klärung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern zu lange dauert.“ Damals gab es einen Fördervertrag mit Train of Hope und anderen NGOs, die in der Akutversorgung – also auf den Bahnhöfen und in den Notquartieren – tätig waren. NGOs erhielten zumindest einen Großteil der Kosten ersetzt, um Lebensmittel heranzuschaffen und die Infrastruktur zu finanzieren, die notwendig war, um den Betrieb am Laufen zu halten. In den vergangenen Jahren hatte Train of Hope und ihre neu gegründete Schwesterorganisation House of Hope versucht, aus den Ereignissen von 2015 die Lehren zu ziehen um für eine neue Krise vorbereitet zu sein. In Lagern sammelten sie Kleider aller Größen, Schlafsäcke für Babys oder auch tausende Plastikbecher und Besteck, etwas, das 2015 innerhalb kürzester Zeit nicht mehr verfügbar war, aber zur Überbrückung bis zum Aufbau der Infrastruktur bei großen Flüchtlingsaufkommen äußerst wichtig ist. Etwa bis der Geschirrspülwagen der MA48 verfügbar ist. Und auch diesmal gelang es, mit Cateringbetrieben, Restaurants und Firmen Kooperationen abzuschließen, um den hohen Bedarf an Essensrationen zu sichern. Das Ankunftszentrum versorgte in den ersten Wochen täglich 1.000 bis 1.200 Menschen, denen man neben Verpflegung (auch für teils kranke Haustiere) und ärztlicher Versorgung Ruhe- und Spielplätze für Kinder sowie WLAN für den Kontakt nach Hause ermöglichte.

Hygieneartikel, Babywindeln, Durschgel, die Spendenbereitschaft ist groß. Train of Hope hatte aber bereits nach 2015 begonnen, Lager mit Kleidung und Hilfsgütern anzulegen – für die nächste Krise.
Versorgungskette mit Lücken
Auch wenn sich derzeit die Anzahl der Neuankömmlinge verringert hat, kommen dennoch täglich einige hundert Menschen hierher. Mitte Mai bei einem Besuch sind es drei mal so viele Wiederkehrer wie Neuankömmlinge. Dafür gibt es auch einen Grund. Andresen dazu: „Das zeigt, dass der nächste Schritt in der Versorgung noch nicht funktioniert. Wir sind ja als Ankunftszentrum konzipiert, die zweite Station ist das Austria Center, wo die polizeiliche Registrierung und der Antrag auf Grundversorgung gestellt wird. Danach sind die Leute im Regelsystem. Was wir erleben, ist aber, dass ganz viele Menschen zu uns zurückkommen, weil sie festhängen. Entweder, weil sie noch keinen Antrag auf Grundversorgung stellen konnten, noch keinen Termin erhalten haben oder weil sie zum Beispiel in Unterkünften wohnen, in denen sie keine Meldeadresse erhalten, womit sie keine Leistungen beziehen können.“ So wird das Ankunftszentrum zum Tageszentrum, was freilich nicht so geplant war. Mittlerweile häufen sich Berichte von Frauen, etwa auch in Niederösterreich und Oberösterreich, deren Ersparnisse aufgebraucht sind und und aufgrund mangelnder Betreuung wieder hilfesuchend ins Ankunftszentrum zurückkehren. Hier fragen sie auch um Hygieneartikel oder Sommerkleidung an. Das alles sei eigentlich nicht die Aufgabe des Ankunftszentrums, sagt Andresen. „Aber Menschen, die nicht versorgt sind, die Hunger haben, die sonst auf der Straße betteln müssten, das ist für uns keine Option.“

In der Ankunftshalle wurde an alles gedacht: Es gibt einen Bereich für Kinder und Jugendliche für Ballspiele, oder auch um etwas zu malen, vielleicht einige Erlebnisse zu verarbeiten.
Während der mittlerweile bestellte Flüchtlingsberater Michael Takacs betont, dass alle geflüchteten Menschen gut versorgt würden, können das NGOs nicht bestätigen. Auch drei Monate nach Kriegsbeginn wirkt noch einiges wie eine große Baustelle. Dabei sollten die Anlaufschwierigkeiten der ersten Wochen längst überwunden sein. Damals standen Frauen und Kinder teils stundenlang im eisigen Wind auf der Donauplatte vor dem Austria Center, weil das durchwegs engagierte Personal mit der Bearbeitung nicht nachkam. Es dauerte einige Zeit, bis die wichtigsten Kompetenzen geklärt waren und die Koordination der Ukraine- Flüchtlinge schließlich bei der BBU landete, der „Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen“, die vor allem als „Rückkehrberatung“ bekannt ist. Nun scheint das politische Mikado über die Aufteilung der Kosten zwischen Bund und Ländern weiterzugehen. Der niederösterreichische Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) fiel mit dem Vorschlag auf, Asylwerber*innen aus Einrichtungen in Containerdörfer zu verbringen und dafür an den freigewordenen Orten Menschen aus der Ukraine unterzubringen. Gleichsam die „kulturfremden“ Burschen aus Afghanistan raus und die Mütter und Kinder im Sinn der europäischen „Nachbarschaftshilfe“ rein in die Quartiere. Damit bestätigte Waldhäusl indirekt die öfters geäußerte Kritik an der Ungleichbehandlung der Geflüchteten von 2015 und heute. Tatsächlich betont die Regierung gerne, dass man den Ukraine-Flüchtlingen besonders unbürokratisch und rasch geholfen habe. Mit dem extra eingerichteten Status der „Vertriebenen“ muss kein jahrelanger Asylprozess durchlaufen werden, die so genannte „Blaue Karte“ ermöglicht einen sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt. Manuela Ertl von Train of Hope sieht das etwas differenzierter: „Die Hilfe in Österreich basiert ja auf einer EU-Direktive, der ‚Massenzustrom Richtlinie‘, die es seit 2001 gibt. Nun wurde sie aktiviert und Österreich setzt gerade einmal das Minimum davon um, was die EU vorschreibt.“ Der Vorteil der Richtlinie für die Mitgliedstaaten sei, dass sie sich die Personalkosten und den Aufwand des Asylverfahrens ersparen. Zugleich werden die Menschen aber nicht den Asylberechtigten gleich- sondern deutlich schlechter gestellt. Ertl: „Es ist ein gravierender Unterschied, ob die Menschen in der Grundversorgung sind oder Mindestsicherung erhalten. In der Grundversorgung unterliegen sie den Grundversorgungsstandards und werden einzelnen Quartieren in den Bundesländern zugewiesen. Das heißt konkret, dass eine alleinstehende Frau mit fünf anderen Menschen in ein Zimmer zugewiesen werden kann. Zudem erhält sie deutlich weniger Geld.“ Für privat untergebrachte Personen gibt es einen Wohnzuschuss bis zu 150 Euro, dazu ein Essensgeld von 215 Euro. Das ist die gesamte finanzielle Unterstützung nach der Grundversorgung.

Clowns im Einsatz, um die Kinder in schwierigen Zeiten aufzumuntern.
Nach dem Asylverfahren würde eine Einzelperson hingegen die vollen Leistungen der Mindestsicherung erhalten. Ertl findet, dass sich die Politik zu Unrecht rühmt, gut und unbürokratisch zu helfen, vielmehr bewege sich die finanzielle Hilfe auf einem absoluten Minimum. Derzeit laufen erste Gespräche, welchen Status die Ukraineflüchtlinge mittelfristig erhalten sollen. Innenminister Gerhard Karner schlägt ein Zuverdienstmodell vor, das allerdings nur für Vertriebene aus der Ukraine gelten soll – und nicht für alle Flüchtlinge, wie NGOs fordern. Ohne Sprachkompetenzen und Kinderbetreuung ist das ohnehin ein schwieriges Thema. Es braucht einen Plan für die mittlerweile 52.000 Menschen, die sich in der Grundversorgung befinden, für die 72.000, die bislang registriert wurden, und für alle, die noch kommen.
Spendenkonto Train of Hope
IBAN AT212011182751297500
www.facebook.com/trainofhope.wien/
Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo