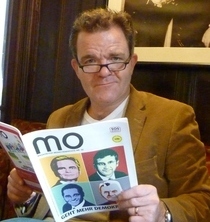„Wichtig ist, nicht wegzuschauen“
Vor einem Jahr löste der Tod der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini große Proteste im Iran aus. Tausende Menschen gingen für Freiheit und ein würdevolles Leben auf die Straße. Das MO-Magazin führte Gespräche mit Iranerinnen in Österreich: über ihr altes und neues Leben, und was echte Solidarität bedeutet. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Interviews: Milena Österreicher
„Es macht mich stolz, wie iranische Frauen für ihre Freiheit kämpfen“
Nasrin und Shirin* sind zwei Frauen aus Teheran. Nachdem Familienmitglieder nach den Protesten im Gefängnis landeten und Drohungen erhalten, wurde das Gespräch anonymisiert.

Weltweit solidarisieren sich Menschen mit den Protestierenden im Iran, so wie hier bei einem Protest im November 2022 in Mailand, Italien
MO-Magazin: Sie sind vor einigen Jahren nach Österreich gekommen. Was hat Sie nach Wien geführt?
Shirin: Wir sind gekommen, um zu studieren, aber auch, weil wir in Freiheit leben wollten. Wir waren sehr begeistert, weil wir uns total frei gefühlt haben.
Nasrin: Es war nicht immer einfach für uns in Wien, aber ich konnte zum Beispiel meine künstlerischen Arbeiten zeigen, ohne sie zensurieren zu müssen.
Shirin: Besonders schwer war es für mich, als meine Mutter im Iran verstorben ist und wir die letzten Jahre nur über WhatsApp kommunizieren konnten. Das macht mich traurig.
Nasrin: Das Leben in Österreich ist für mich friedlich und frei. Aber ich hatte auch Schwierigkeiten, weil ich wieder alles von Neuem beginnen musste: eine neue Sprache lernen, neue Kontakte aufbauen, einen neuen Job finden.
Wie war Ihr Leben zuvor im Iran?
Shirin: Wie viele Frauen im Iran, wurde ich oft von der Polizei verhaftet: auf der Straße, auf dem Weg zur Universität, in meinem Auto oder im Park. In ihren Augen habe ich mein Kopftuch nicht richtig getragen. Ich musste immer eine Strafe zahlen. Es war jedes Mal eine enorme Stresssituation für mich.
Nasrin: Ich verfolge heute noch mehrmals am Tag die Nachrichten aus dem Iran. Sie haben einen direkten Einfluss auf mein Leben.
Sie leben nun in Österreich. Ist dennoch auch Angst geblieben?
Nasrin: Ja, natürlich. Vor allem weil wir ja auch noch Familie und Freund*innen im Iran haben. Aber wenn ich denke, dass die Leute im Iran mutig auf die Straße gehen und ihr Leben riskieren, dann kann ich nicht sagen: Nein, das mache ich nicht, weil ich Angst habe. Ich bin jetzt an einem sicheren Ort und wir können hier zumindest die Stimme für die Menschen im Iran erheben.
Shirin: Das ist das Mindeste, was wir machen können.
Nasrin: Es geht immer noch weiter, obwohl sich der Protest auch verändert hat. Es gibt nicht mehr die ganz großen Proteste auf der Straße, aber dennoch jeden Tag Widerstand. Viele Menschen zeigen, dass sie nicht mehr akzeptieren, so zu leben und unter Druck zu sein. Frauen gehen weiterhin ohne Kopftuch auf die Straße, obwohl sie wissen, dass es strafbar ist und es wirklich große Probleme geben kann, zum Beispiel, dass sie ihren Job verlieren.
Shirin: Es gibt viele Gründe für diese Proteste und die Revolution. Aber es ist eine feministische Bewegung, die Frauen sind an vorderster Front.
Was wünschen Sie sich?
Nasrin: Wir erwarten, dass europäische Länder Druck auf das Regime ausüben und es nicht anerkennen, wenn es gegen das eigene Volk vorgeht. Wir verstehen auch nicht, dass Vertreter*innen des Regimes in Europa, den USA oder Kanada Urlaub machen, die Kinder in die Schule gehen und studieren können, während wir Schwierigkeiten haben, ein Visum für ein Leben in einem freien Land zu bekommen.
Shirin: Ich habe es zehn Jahre lang in verschiedenen Ländern versucht, bis es schließlich mit dem Visum in Österreich geklappt hat. Dennoch möchte ich auch sagen, dass wir nicht vergessen, woher wir gekommen sind. Ich bin stolz, Iranerin zu sein, denn jeder weiß – spätestens jetzt –, wie iranische Frauen für ihre Freiheit kämpfen. Ich wünsche mir, dass alles ein gutes Ende nimmt.
„Ich wünsche mir mutige Politiker*innen“
Ulduz Ahmadzadeh kam vor fünfzehn Jahren zum Studium nach Österreich. Seither verfolgt die Tänzerin und Choreographin ihre Leidenschaft Tanzen, die im Iran verboten ist.

Die Tänzerin und Choreographin Ulduz Ahmadzadeh wünscht sich konkrete Handlungen: „Für viele Frauen ist es schwierig, in Österreich Zuflucht zu finden“.
MO-Magazin: Im September jährt sich der Todestag von Jina Mahsa Amini und der Start der folgenden Großproteste im Iran. Wie blicken Sie heute zurück auf die Bewegung und die Ereignisse, die folgten?
Ulduz Ahmadzadeh: Es ist so erschreckend und traurig, dass ich im Alltag gar nicht wirklich daran denken kann. Ich habe das Gefühl, im Vergleich dazu, was alles passiert ist – nämlich so viel Gewalt, Verhaftungen, Folter, Exekutionen –, ist noch immer nicht genügend Aufmerksamkeit da. Dennoch wurden viele Dinge erreicht. Ich habe den Eindruck, dass sich das Bewusstsein in der Gesellschaft verändert hat, zum Beispiel wie Frauen ihren Körper wahrnehmen, etwa ohne Kopftuch auf die Straße gehen. Man sieht auf Fotos und Videos, wie unglaublich mutig und selbstbewusst sie sind. Ich werde auch in meiner tänzerischen Arbeit sehr inspiriert von diesen Frauen, und besonders auch von allen, die durch das Tanzen Widerstand zeigen. Frauen und Männer haben gesehen, was sie bewegen können. Das ist sehr wichtig. Dennoch fällt es mir angesichts der massiven Gewalt, die sich im vergangenen Jahr gezeigt hat, schwer, diese Erfolge gleichzeitig mit positiven Gefühlen zu verknüpfen.
Welchen Appell haben Sie an die europäische Zivilgesellschaft und Politik?
Es fallen viele Solidaritätsworte. Ich war dieses Jahr beispielsweise am 8. März, dem Internationalen Frauentag, in die Hofburg eingeladen. Die Veranstaltung war den Frauen im Iran und in Afghanistan gewidmet. Bundespräsident Van der Bellen meinte, dass wir nun alle an der Seite der Frauen in den beiden Ländern stehen und sie unterstützen müssten. Das sind schöne Worte, de facto ist es für diese Frauen aber unglaublich schwierig etwa in Österreich Zuflucht zu finden. Wir haben auch für eine Familienangehörige ein Visum beantragt und warten seit einem Jahr auf die Entscheidung. Ich wünsche mir mutige Politiker*innen, die auch wirklich handeln. Wir brauchen auf nationaler sowie internationaler Ebene gemeinsame Handlungen gegen das Regime. Und eine starke Zivilgesellschaft, die das fordert – denn dann muss auch die Politik in Bewegung kommen.
2008 haben Sie den Iran verlassen und sind als Studentin nach Wien gekommen. Wie haben Sie Österreich in diesen 15 Jahren erlebt?
Ich habe zu Beginn alles als sehr schön und offen empfunden. Damals habe ich auch relativ schnell und unkompliziert ein Student*innen-Visum bekommen. Das wäre jetzt wohl nicht mehr so möglich. Heute habe ich das Gefühl, dass die allgemeine Stimmung viel aufgeheizter und aggressiver ist – auf politischer, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene. Ich habe auch eine andere Wahrnehmung, seitdem ich hier Mutter von drei Kindern bin. Ich spreche mit ihnen meine Muttersprache Farsi. Auf der Straße werde ich dafür sehr schief angeschaut. In meiner Student*innen-Zeit wurde ich eher noch neugierig und interessiert aufgenommen.
„Wir können uns jeden Tag solidarisch zeigen“
Maryam Mohammadi war im Iran als Fotografin und Dozentin an der Kunstuniversität in Teheran tätig. Seit 2009 lebt sie in Graz und arbeitet als Fotografin und Kuratorin.

Die Fotografin und Kuratorin Maryam Mohammadi bindet das Thema Rassismus in ihre künstlerische Arbeit ein: „Viele Migrant*innen sind bis heute nicht in Österreich willkommen“.
MO-Magazin: In Ihrer künstlerischen Arbeit geht es oft um die Diskriminierung von Frauen. Warum wählen Sie dieses Thema?
Maryam Mohammadi: Ich habe mich immer schon mit den unterschiedlichen Möglichkeiten, die Frauen und Männer in einer Gesellschaft haben, beschäftigt. Auch meine Dissertation habe ich zum Thema Fotografie und Feminismus geschrieben. Als ich eine junge Dozentin an der Uni war, haben meine älteren männlichen Kollegen mir zwar nie direkt gesagt, dass sie ein Problem mit mir an der Uni haben, aber sie haben mich das immer wieder spüren lassen. Sie haben sich beispielsweise darüber beschwert, dass ich meine Studierenden beim Vornamen genannt habe. Ich habe das gemacht, weil wir ja in einem ähnlichen Alter waren.
In Graz sind Sie derzeit Co-Kuratorin der Ausstellung „Aus dem Iran“, die noch bis 10. Dezember 2023 im Graz Museum zu sehen ist. Worum geht es?
Die Ausstellung, die ich gemeinsam mit Joachim Hainzl kuratiert habe, handelt von einem wichtigen Teil der Grazer Stadtgeschichte: den iranischen Studierenden, die in den 50er- bis 70er-Jahren in Graz lebten. In der Ausstellung erzählen sie von dieser Bildungsmigration, ihrem politischen Aktivismus und ihrem Leben in Graz.
Wie ist es Ihnen in Graz ergangen, als Sie 2009 zum Studium hierhergezogen sind?
Es ist mir ganz gut gegangen, ich habe erst später verstanden, mit welchen Problemen Migrant*innen hier zu kämpfen haben. Als ich einmal wegen einer Visumsangelegenheit bei der Behörde in Graz war, hat mir die Dame nach ein paar Sekunden gesagt, dass ich sehr brav Deutsch spreche. Ich dachte bis dahin, dass man „brav“ nur zu Kindern oder Tieren sagt. Sie war sehr nett zu mir. Als danach die Frau hinter mir dran war, wurde die Dame am Schalter sehr laut und unhöflich. Die Frau hinter mir trug Kopftuch und hatte ihre Kinder dabei. Ich dachte damals, was ist nun der Unterschied zwischen mir und dieser Frau? Viele Migrant*innen sind hier immer noch nicht willkommen. Es werden Frauen aufgrund ihrer Hautfarbe, eines Kopftuchs oder ihrer Deutschkenntnisse oft ungleich behandelt. Ich versuche das Thema Rassismus immer auch in meinen künstlerischen Projekten zu bearbeiten und engagiere mich im Projekt DIVAN der Caritas, das mit gewaltbetroffenen Frauen arbeitet.
Sie zeigen sich immer wieder solidarisch mit Frauen. Was bedeutet Solidarität für Sie?
Solidarität ist so wichtig. Wenn es etwa um Krisen geht, bestimmen meist die Medien, was und wer unsere Aufmerksamkeit erfährt. Wann haben wir beispielsweise zuletzt über die Situation der Frauen in Afghanistan etwas gehört? Wer denkt an sie? Wir können uns aber auch im Alltag jeden Tag solidarisch zeigen. Das kann ein Nachfragen, ein Zusammensitzen, ein gemeinsames Kaffeetrinken sein. Als die ersten großen Proteste im Iran losgebrochen sind, kamen meine Kolleg*innen immer zu mir und fragten mich „Bist du okay?“, bevor sie mir eine Tasse Kaffee einschenkten und sich zu mir setzten. Oder als das schreckliche Erdbeben in der Türkei war, bemerkte ich, dass einige türkische Kolleg*innen mit verweinten Augen kamen. Wir sind dann zusammengesessen und haben gesprochen. Wichtig ist, nicht wegzuschauen – nicht bei Gewalt, nicht bei Rassismus, nicht bei Diskriminierung. Das würde allen Menschen helfen.
*Namen von der Redaktion geändert
Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo