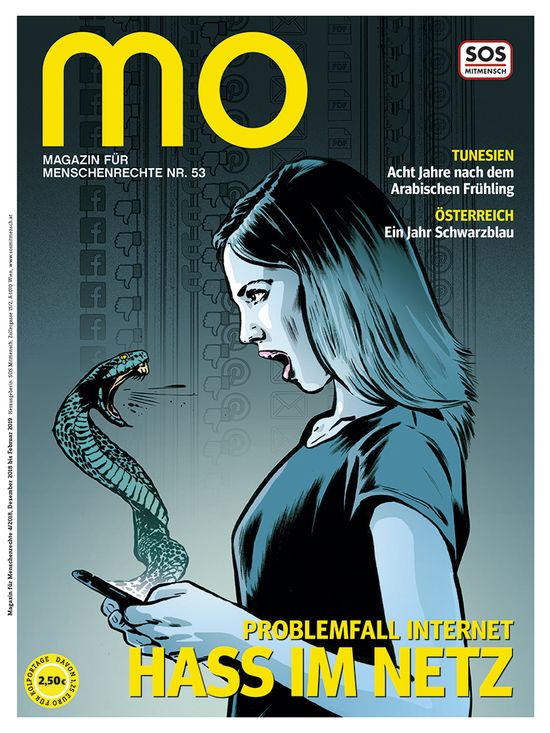Acht Jahre Arabischer Frühling. Und jetzt?
Tunesien ist das einzige Land, dessen demokratischer Aufbruch nach dem Arabischen Frühling erfolgreich verlief. Doch Unmut regt sich. Ein Lokalaugenschein. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Text: Nour-El-Houda Khelifi, Fotos: Hibat-Ullah Khelifi
Ich stehe oben am D eck auf der Fähre Richtung Tunis. 18 Stunden vorher haben wir in der italienischen Hafenstadt Civitavecchia abgelegt. Endloses Blau, wohin das Auge blickt, das Wasser relativ ruhig und glitzert im Sonnenlicht. Ein beruhigender Anblick. Aber ich denke an all die unzähligen Menschen, die ihr Leben in diesen Gewässern verloren haben, mit der Hoffnung auf ein besseres Leben, mit der Hoffnung, gerettet zu werden. Das Mittelmeer ist mittlerweile ein Massengrab für Migrantinnen und Migranten geworden. Am Abend zuvor höre ich ein Gespräch auf dem Deck. Einige Urlauber mit tunesischen Wurzeln möchten für die Verstorbenen im Mittelmeer das islamische rituelle Totengebet verrichten. Alleine 2018 sind bereits mehr als 1.500 Menschen auf der gefährlichen Überfahrt nach Europa ertrunken. Die Zahl der Rettungsschiffe ist gesunken, EU-Politikerinnen und Politiker bezeichnen die Helferinnen und Helfer als Schleuserbanden. Das Sterben hört trotzdem nicht auf, wer überlebt und in Europa gefasst wird, wird abgeschoben. Die Menschen suchen verzweifelt noch gefährlichere Fluchtrouten. Das Sterben im Mittelmeer hat sich in die Sahara verlagert.
eck auf der Fähre Richtung Tunis. 18 Stunden vorher haben wir in der italienischen Hafenstadt Civitavecchia abgelegt. Endloses Blau, wohin das Auge blickt, das Wasser relativ ruhig und glitzert im Sonnenlicht. Ein beruhigender Anblick. Aber ich denke an all die unzähligen Menschen, die ihr Leben in diesen Gewässern verloren haben, mit der Hoffnung auf ein besseres Leben, mit der Hoffnung, gerettet zu werden. Das Mittelmeer ist mittlerweile ein Massengrab für Migrantinnen und Migranten geworden. Am Abend zuvor höre ich ein Gespräch auf dem Deck. Einige Urlauber mit tunesischen Wurzeln möchten für die Verstorbenen im Mittelmeer das islamische rituelle Totengebet verrichten. Alleine 2018 sind bereits mehr als 1.500 Menschen auf der gefährlichen Überfahrt nach Europa ertrunken. Die Zahl der Rettungsschiffe ist gesunken, EU-Politikerinnen und Politiker bezeichnen die Helferinnen und Helfer als Schleuserbanden. Das Sterben hört trotzdem nicht auf, wer überlebt und in Europa gefasst wird, wird abgeschoben. Die Menschen suchen verzweifelt noch gefährlichere Fluchtrouten. Das Sterben im Mittelmeer hat sich in die Sahara verlagert.
Acht Jahre nach dem Arabischen Frühling gilt Tunesien immer noch als Vorzeigebeispiel der Demokratisierung in der arabischen Welt. Zu den Wahlen 2011 traten 80 Parteien an, stärker könnte der Kontrast zu den Wahlen unter dem autokratisch regierenden Präsidenten Zine El-Abidine Ben Ali nicht sein. Er floh nach anhaltenden Protesten nach Saudi Arabien. Heute führen hohe Jugendarbeitslosigkeit und Korruption immer wieder zu landesweiten Demonstrationen. Die politische Landschaft wird seither von zwei Fronten geprägt: die säkulare Sammlungspartei Nidaa Tounes („Ruf Tunesiens“), die wesentlich die tunesische Elite mitprägt, und die islamistische Ennahda („Bewegung der Wiedergeburt“), eine volksnahe Partei, die das Potenzial zu einem neuen Islam hat, der Menschenrechte und Rechtsstaat achtet. Schwierig ist die Lage in Tunesien, einem Land doppelt so groß wie Österreich, auch durch über zwei Millionen Flüchtlinge aus Libyen. Eine Herausforderung für die Politik, die Lage auch wirtschaftlich stabil zu halten.
Wir haben noch eine Stunde, bis die Fähre anlegt, und schon jetzt sieht man den Müll im Wasser. Plastik in allen Formen und Farben schwebt durch das Marineblau. Die Küste von Tunis wird im Dunst der Hitze erkennbar. Ein Gefühl von Vertrautheit macht sich in mir breit. Aber auch Unbehagen. Jedes Jahr fahre ich nach Tunesien, jedes Jahr erscheint es mir vertrauter und fremder zugleich. Vor acht Jahren trieben Arbeitslosigkeit und Unterdrückung Hunderttausende auf die Straßen. Als sich der junge Gemüsehändler Mohammed Bouazizi im Dezember 2010 aus Protest gegen bürokratische Schikanen selbst verbrannte, kippten die Proteste, der Sturz des Kleptokraten Ben Ali war besiegelt. Das Volk war euphorisch, feierte, endlich frei von Ben Ali, endlich frei vom Trabelsi-Clan von Ben Ali’s Ehefrau.
„Unter Ben Ali war alles besser“
Heute ist von der Euphorie nich t mehr viel übrig. Eine Statistik der Wirtschaftskammer weist die Arbeitslosigkeit für 2018 mit 15 Prozent aus, unter den Jugendlichen ist sogar jeder dritte ohne Job. Nur wenige Jahre nach der Revolution wünschen sich die ersten Stimmen wieder den alten Führer Ben Ali zurück. Auch meine Verwandten in Tunesien und unsere dortigen Nachbarn sind sich ziemlich einig: Unter Ben Ali war alles besser. Ich bin geschockt. Ich kann nicht nachvollziehen, warum die Leute bereit sind, die Beschneidung der eigenen Freiheit für mehr finanzielle Stabilität in Kauf zu nehmen. Hat man so schnell vergessen, wie das Leben davor war? Angekommen in unserem Ferienhaus in Somaa, einem Vorort des Touristen-Hotspots Nabeul empfängt uns Sonia, unsere Nachbarin. Sie ist Lehrerin an einem Gymnasium und gehört damit zu den TopverdienerInnen des Landes. Sie freut sich, uns wieder zu sehen, und gibt uns erste direkte Einblicke in die politische und wirtschaftliche Lage Tunesiens. Ihr Sohn hat im heurigen Sommer die Matura bestanden, nun möchte er um jeden Preis nach Europa. Um zu studieren und viel Geld zu verdienen. Ich versuche zu reflektieren, woher diese Idealisierung und Ikonisierung des Lebens in Europa rührt. Auch seine Mutter bittet uns, ihm diese Idee auszureden, das finanzielle Risiko sei viel zu hoch für die Familie. Zugleich hadert auch Sonia mit dem Leben in Tunesien und gesteht, dass auch sie sich Ben Ali zurückwünscht. „Da gab es noch Sinn für Ordnung und die Menschen hatten Angst vor dem Gesetz, besser gesagt vor den Gesetzeshütern. Schau dich jetzt auf der Straße um. Überall Menschen, die das Gesetz missachten. Kein Polizist kann widersprechen, wenn ihm sein Leben lieb ist “, erzählt sie und schüttelt ungehalten den Kopf. Ich weiß nicht, was ich darauf erwidern soll.
t mehr viel übrig. Eine Statistik der Wirtschaftskammer weist die Arbeitslosigkeit für 2018 mit 15 Prozent aus, unter den Jugendlichen ist sogar jeder dritte ohne Job. Nur wenige Jahre nach der Revolution wünschen sich die ersten Stimmen wieder den alten Führer Ben Ali zurück. Auch meine Verwandten in Tunesien und unsere dortigen Nachbarn sind sich ziemlich einig: Unter Ben Ali war alles besser. Ich bin geschockt. Ich kann nicht nachvollziehen, warum die Leute bereit sind, die Beschneidung der eigenen Freiheit für mehr finanzielle Stabilität in Kauf zu nehmen. Hat man so schnell vergessen, wie das Leben davor war? Angekommen in unserem Ferienhaus in Somaa, einem Vorort des Touristen-Hotspots Nabeul empfängt uns Sonia, unsere Nachbarin. Sie ist Lehrerin an einem Gymnasium und gehört damit zu den TopverdienerInnen des Landes. Sie freut sich, uns wieder zu sehen, und gibt uns erste direkte Einblicke in die politische und wirtschaftliche Lage Tunesiens. Ihr Sohn hat im heurigen Sommer die Matura bestanden, nun möchte er um jeden Preis nach Europa. Um zu studieren und viel Geld zu verdienen. Ich versuche zu reflektieren, woher diese Idealisierung und Ikonisierung des Lebens in Europa rührt. Auch seine Mutter bittet uns, ihm diese Idee auszureden, das finanzielle Risiko sei viel zu hoch für die Familie. Zugleich hadert auch Sonia mit dem Leben in Tunesien und gesteht, dass auch sie sich Ben Ali zurückwünscht. „Da gab es noch Sinn für Ordnung und die Menschen hatten Angst vor dem Gesetz, besser gesagt vor den Gesetzeshütern. Schau dich jetzt auf der Straße um. Überall Menschen, die das Gesetz missachten. Kein Polizist kann widersprechen, wenn ihm sein Leben lieb ist “, erzählt sie und schüttelt ungehalten den Kopf. Ich weiß nicht, was ich darauf erwidern soll.
Wir kommen am Strand in Tazerka an, zehn Minuten Fahrtzeit von unserem Haus. Junge Männer in leuchtenden Warnwesten deuten uns, wir sollen anhalten. „Der Parkplatz kostet einen Dinar“, sagt einer von ihnen. Wir weigern uns zu zahlen, schließlich ist der Parkplatz öffentlich. Der selbst ernannte Parkwächter verstrickt sich Widersprüchen und behauptet, die Gemeinde hätte den Platz angemietet. Zugleich winkt er Autos mit örtlichem Kennzeichen einfach durch. Uns dämmert, was hier vor sich geht und warum sich unsere Nachbarin Sonia Ben Ali zurückwünscht. Wir schenken dem Parkwächter eine Tafel Schokolade, Geld wollen wir ihm nicht geben, aus Prinzip. Und weil wir annehmen, dass die Parkwächter mit der Polizei gemeinsame Sache machen. Parkplätze oder Straßen werden von überwiegend männlichen Gruppen in Beschlag genommen. Wer parken möchte, muss zahlen, ansonsten wird das Auto demoliert oder schlimmeres. Um nicht festgenommen zu werden, werden die Einnahmen mit den Polizisten aufgeteilt. Korruption ist in Tunesien immer noch Alltag.
 Früher war Tunesien ein Polizeistaat, die Beamten wurden gefürchtet, nun werden sie geduldet. Heute fehlt den Tunesierinnen und Tunesiern aus anderen Gründen das Vertrauen in den Rechtsstaat. Viel zu lange wurden sie missbraucht, sie leben sich aus. Ganz nach dem Motto „Ihr könnt uns nichts, wir als Volk sind stärker als Ihr.“ So sehr Tunesien im Vergleich zu anderen Ländern stabil erscheint, macht es einen fragilen Eindruck auf mich. Jede Unruhe könnte die Stimmung im Land kippen lassen. Der geflüchtete Despot Ben Ali hat dem Land Milliarden Dollar geraubt und seine Wirtschaft massiv geschädigt. Nun kommt eine Haltung auf, in der sich jeder selbst am nächsten ist. „Ich kann die Tunesier verstehen, jeder versucht, sich sein Stück vom Kuchen zu holen, ganz egal ob es mit dem Gesetz vereinbar ist oder nicht“, erklärt mir ein Familienmitglied.
Früher war Tunesien ein Polizeistaat, die Beamten wurden gefürchtet, nun werden sie geduldet. Heute fehlt den Tunesierinnen und Tunesiern aus anderen Gründen das Vertrauen in den Rechtsstaat. Viel zu lange wurden sie missbraucht, sie leben sich aus. Ganz nach dem Motto „Ihr könnt uns nichts, wir als Volk sind stärker als Ihr.“ So sehr Tunesien im Vergleich zu anderen Ländern stabil erscheint, macht es einen fragilen Eindruck auf mich. Jede Unruhe könnte die Stimmung im Land kippen lassen. Der geflüchtete Despot Ben Ali hat dem Land Milliarden Dollar geraubt und seine Wirtschaft massiv geschädigt. Nun kommt eine Haltung auf, in der sich jeder selbst am nächsten ist. „Ich kann die Tunesier verstehen, jeder versucht, sich sein Stück vom Kuchen zu holen, ganz egal ob es mit dem Gesetz vereinbar ist oder nicht“, erklärt mir ein Familienmitglied.
„Wir essen keinen Fisch mehr.“
Acht Uhr früh, die Sonne brennt bereits vom Himmel. Wir haben die Zweiliter-Wasserflasche stets in unseren Händen. Wir stehen am Wochenmarkt im alten Herzen der Touristenstadt Nabeul, einige Minuten weiter liegt der Bazar. 2017 tummelten sich sieben Millionen TouristInnen durch die Hafenstadt. Die beiden Jahre zuvor war das anders. „Es kamen keine Touristen mehr, weil nur noch mehr Reisewarnungen ausgesprochen wurden, manche Fluglinien haben sich sogar aus Tunesien zurückgezogen“, erzählt ein Standbesitzer am Bazar, während er seine Porzellanwaren abstaubt. Ich gehe weiter und lese die Preisschilder zwischen all den sonnengereiften Tomaten, Chilis und Kaktusfeigen. In meinem Hirn rattert es, ich rechne die Dinar-Preise in Euro um. Ein Kilo Tomaten kostet keine 30 Cent. Für uns EuropäerInnen ein unverschämtes Schnäppchen, für die Einheimischen eine Katastrophe. Seit der Kurs des Dinars so gefallen ist, wird jede Münze zweimal umgedreht. Mir fällt auf, dass beim Wiegen der Ware oft bis zum letzten Groschen gefeilscht wird. Wir machen noch einen kleinen Abstecher zum Fischmarkt. Die Halle ist kühl, eine angenehme Abwechslung, trotz des penetranten Fischgeruchs und dem Marktgeschrei der Fischer. Sardinen, Doraden und Tintenfisch, wohin das Auge reicht. Für drei Kilo Doraden zahlen wir nur zehn Euro, ich komme mir wie eine unverschämt reiche Kolonialherrin vor. Ich sehe mich nach Thunfisch um, den gab es hier früher in Hülle und Fülle – dieses Jahr aber nicht. Kein Wunder, der Thunfisch ist von Überfischung bedroht. Meine Augen fallen auf einen Fisch, der wie ein Hai aussieht. Wir sind irritiert, seit wann wird in Tunesien Hai gegessen? Ich frage nach. Der Verkäufer behauptet, das sei kein Hai, sondern „Chien de mer“, während er den Dornhai filetiert. Ich bleibe dabei, dass das eine Hai-Art ist, währenddessen überredet er meine Eltern, den Fisch zu probieren, am besten frittiert oder in einer deftig-dicken Sauce für Pasta. Mit weiteren zwei Kilo Dornhai gehen wir wieder Richtung Auto. Einige Tage später sind wir bei meiner Tante zum Essen eingeladen. Irgendwann kommen wir auf das Thema Lebensmittel zu sprechen und wie billig Fisch geworden ist. „Wir Tunesier essen seit geraumer Zeit keinen Fisch mehr. Viel zu viele Menschen, die im Mittelmeer ertrunken sind und Fische, die sich vielleicht von den Kadavern ernähren“, sagt mein Onkel. Ich frage, ob das sein Ernst ist. Während die einen ihren Urlaub am Mittelmeer buchen, essen die anderen nichts mehr, was aus diesem Meer gefischt wird? Das ist mir zu viel, ich rede mir ein, dass Fische doch kein Menschenfleisch essen. Schlagartig fällt mir der „Chien de mer“ ein und nehme mir vor, in Österreich nachzuschauen, ob dieser Fisch wirklich zur Haigattung gehört oder nicht.
Xenophobie auch in Tunesien
Zuhause angekommen stoßen wir auf unsere Nachbarin Sonia und sprechen die Preise am Markt an. Genervt schüttelt sie den Kopf. „Alles ist teurer geworden wegen der Touristen aus Algerien. Die kaufen uns alles weg und dann steigen die Preise.“ Ich verkneife mir die Frage, ob ihr das Prinzip von Angebot und Nachfrage vertraut ist. Falls ich etwas in diesen Wochen in Tunesien gelernt habe, dann, dass man die Einheimischen unmöglich eines Besseren belehren kann. Ich bin überrascht von Sonias Unverständnis gegenüber den Algeriern. Schließlich sind sie es, die in Tunesien seit dem Arabischen Frühling den Tourismus und die Wirtschaft ankurbeln, vor allem nachdem die europäischen Touristen ausgeblieben sind. Sonia fragt mich, wie die Situation in Österreich ist. Ich schildere ihr den allgemeinen Rechtsruck in Europa, erzähle von der verschärften Asylpolitik. Die Lehrerin nickt zustimmend. „Ich kann die Österreicher verstehen. All die Leute, die neu kommen, und wegen ihnen wird alles teurer und schlechter.“ Ich muss kurz lachen, Fremdenhass ist also doch überall zu finden. Ich erinnere sie, dass die schlechte Lage in Tunesien nichts mit den Touristen aus dem Nachbarland zu tun hat und dass es der Gesellschaft viel besser ginge, wenn jede Bürgerin und jeder Bürger Steuern entrichten würde. Derzeit zahlt nur Steuern, wer als Beamter beim Staat angestellt ist, also Polizisten oder Lehrkräfte. Für öffentliche Ausgaben, Infrastruktur und anderes steht dem Staat also nicht so viel Geld zur Verfügung. Dafür werden Brot, Zucker, Milch, Öl und Benzin staatlich subventioniert – um den Unmut des Volkes gering zu halten.
Man weiß, der Mix aus verteuerten Lebensmitteln und politischer Unzufriedenheit hat Tunesien schon einmal eine Revolution beschert. Immerhin mit positivem Ausgang. Wie lange der Demokratisierungsprozess in Tunesien noch dauert, bleibt abzuwarten. Nach jahrzehntelanger Kolonisation durch Frankreich und eine hausgemachte Diktatur dürfte es wohl mindestens eine Generation brauchen, bis sich ein demokratisches Grundverständnis in den Köpfen eingenistet hat. Dann sollte Tunesien als demokratisch und wirtschaftlich gefestigtes Land aus dem Arabischen Frühling hervorgegangen sein.
Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo