
Die vergessenen „Gastarbeiterinnen“
Am Beginn vieler österreichischer Migrationsgeschichten steht die Arbeit. So auch bei vielen Frauen aus den Philippinen oder Korea. Erzählt werden die Geschichten dieser „Gastarbeiterinnen“ allerdings bis heute kaum.
Text: Naz Küçüktekin
Ein Beitrag im neuen MO - Magazin für Menschenrechte.
Jetzt mit einem MO-Solidaritäts-Abo unterstützen!
Mehr als 10.000 Kilometer Luftlinie entfernt von ihrer Familie hat für Leonora Rayo vor knapp acht Monaten ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Im Februar 2024 verabschiedete sich die 34-jährige ausgebildete Krankenpflegerin von ihrem 15-jährigen Sohn und ihrem Ehemann, um von Manila, der Hauptstadt der Philippinen, an das andere Ende der Welt zu fliegen. Denn in Österreich wartete schon ein Arbeitsvisum sowie ein Vertrag für eine Stelle in einem Pflegeheim auf sie.
Seit Anfang März 2023 arbeitet sie in der Casa Kagran im 22. Wiener Bezirk, in dem mehr als 100 Senior:innen betreut werden. „Es läuft gut,“ antwortet Rayo auf die Frage, wie es ihr gehe. Die Arbeit sei leichter als auf den Philippinen. Hier müsse sie keine 12-Stunden-Schichten machen. Auch mit der Sprache tue sie sich immer leichter. Acht Stunden in der Woche lernt sie in einem Kurs fachspezifisches Vokabular.
_______
DIE MEDIZINISCHE VERSORGUNG IHRES SOHNES IST
TEUER. SO BESCHLOSS RAYO, HIER ZU ARBEITEN.
_______
Ihre Freizeit verbringt sie vor allem mit vier anderen Frauen aus den Philippinen, die zeitgleich mit ihr in dem Pflegeheim zu arbeiten begonnen haben. Ihre Familie ruft Rayo jeden Tag an. Morgens und abends. „Aber manchmal will mein Sohn nicht mit mir sprechen“, erzählt sie. Er nehme es ihr wohl übel, dass sie nun so weit weg von ihnen ist.
Es sind tausende philippinische Pflegekräfte, die jedes Jahr ihr Heimatland verlassen, um im Ausland zu arbeiten. Laut dem philippinischen Gesundheitsministerium arbeiteten im Jahr 2021 mehr als die Hälfte der Pflegerinnen im Ausland.

Leonora Rayo ist eine der vielen Pflegekräfte von den Philippinnen, die zur Arbeit nach Österreich gekommen sind. Die Entfernung zur Heimat und der Familie erschwert das Leben im neuen Land.
Abwanderung gut ausgebildeter Menschen
Auf den Philippinen gebe es durchaus eine Strategie, Personen im Pflegebereich für eine spätere Migration auszubilden, sagt Petra Dannecker, Leiterin des Instituts für Internationale Entwicklung der Universität Wien. Finanziert werde dies jedoch von den philippinischen Steuerzahler:innen. Und für das Land selbst bedeute es eine Abwanderung gut ausgebildeter junger Menschen.
Für Leonora Rayo war die Möglichkeit, ihrer Familie mit ihrem neuen Job finanziell aushelfen zu können, die Hauptmotivation auszuwandern: „Anfangs wollte das meine Familie eigentlich gar nicht, aber dann haben sie eingesehen, dass es das Beste für unseren Sohn ist.“ Er hat von Geburt an eine schwere Behinderung und sitzt im Rollstuhl. Seine medizinische Versorgung sei teuer und werde kaum von der philippinischen Gesundheitskasse übernommen. 400 Euro verdient eine diplomierte Kranken- und Gesundheitspflegerin im Schnitt umgerechnet auf den Philippinen. In Österreich kann Rayo mit ihrer Ausbildung rund das Fünffache erwirtschaften.

Christiane Gotz setzt sich dafür ein, dass auch die Geschichten der nachfolgenden Generationen erzählt werden.
Buhlen um ausländische Fachkräfte
Mit diesem Wissen und angesichts des sich zunehmend zuspitzenden Pflegenotstands buhlen westliche Länder immer mehr um Menschen wie Rayo. Auch Österreich mischt hier ganz vorne mit. Heimische Spitäler und Pflegeeinrichtungen kämpfen seit Jahren mit einem Personalmangel, die Corona-Krise hat die Lage zusätzlich verschärft. Aktuell sind österreichweit 7.500 Stellen im Pflegesektor unbesetzt. Berechnungen des Sozialministeriums gehen davon aus, dass bis 2030 76.000 Beschäftigte fehlen werden.
Um Fachkräfte anzuwerben, reiste der Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich, Karlheinz Kopf, im Oktober 2023 höchstpersönlich mit einer Delegation nach Manila. Schon im Juli zuvor hatten die Wirtschaftskammer, die Stadt Wien sowie die philippinische Botschaft ein Anwerbeabkommen, ein sogenanntes Memorandum of Understanding unterzeichnet. Auch das österreichische Arbeits- und Wirtschaftsministerium schloss im Vorjahr mit den Philippinen ein solches Abkommen ab. Dieses ermöglicht unter anderem einen einfacheren Zugang zur Rot-Weiß-Rot-Karte – und damit zum österreichischen Arbeitsmarkt. Umfassende Vorabinformationen über das Zielland und den konkreten Job sowie Deutschkurse sollen den Prozess erleichtern. Fehler der Vergangenheit, wo auf genau diese Unterstützungsmaßnahmen wenig Wert gelegt wurde, sollen so nicht wiederholt werden.
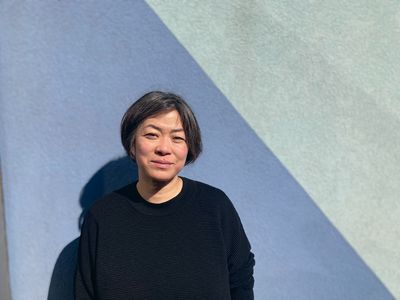
„Migrationsgeschichte findet in Österreich kaum Platz“, sagt Vina Yun. Migration sei aber vielmehr die Normalität, nicht die Ausnahme.
Unsichtbare Migrationsgeschichten
Denn Menschen aus dem Ausland zu rekrutieren, um Lücken am österreichischen Arbeitsmarkt zu füllen – das ist schließlich kein neues Prinzip. Bereits ab den 1970er Jahren war das sogenannte „Gastarbeiter“-Konzept gang und gäbe. Österreich erlebte zu der Zeit ein Wirtschaftswunder, Arbeitskräfte wurden händeringend gesucht. Mit Menschen aus dem Ausland wollte man sich aushelfen. Die „Gastarbeiter“ sollten ihre Dienstleistung zur Verfügung stellen, dann aber auch wieder gehen. Das war zumindest der Plan. Heute weiß man: Große migrantische Communitys, wie die türkische oder ex-jugoslawische, gehen vor allem auf diese Zeit und diese Menschen zurück. Aus den „Gästen“ wurden mit der Zeit Mitbürger:innen.
Wird die Geschichte von sogenannten „Gastarbeiter:innen“ erzählt, finden Menschen, vor allem Frauen, aus Ländern wie den Philippinen, aber auch Korea und Indien allerdings kaum Erwähnung. Dabei kamen von 1973 bis 1985 im Rahmen eines Rekrutierungsprogramms einige Hundert philippinische, koreanische, aber auch indische Krankenschwestern nach Österreich.
Vina Yun, selbst 1974 als Tochter koreanischer Einwander:innen in Österreich geboren, folgt in ihrem 2017 erschienenen Werk „Homestories“ eben dieser kaum erzählten Migrationsgeschichte. In dem semidokumentarischen Comic erzählt sie vom Aufwachsen der Kinder von koreanischen Einwander:innen von damals sowie der sogenannten zweiten Generation.
_______
BEI DER GESCHICHTE DER „GASTARBEITER:INNEN“ FINDEN
MENSCHEN AUS ASIEN KAUM ERWÄHNUNG.
_______
„Bei der ersten Generation war der Fokus vor allem, sich anzupassen. Von daher hat sich diese Gruppe vielleicht sogar überintegriert. Mir wurde zum Beispiel die Sprache meiner Mutter nicht weitergegeben“, erzählt auch Christiane Gotz. Die Tochter einer Filipina und eines Österreichers brachte 2022 den Sammelband „Common Diversities: Junge Filipin@s im deutschsprachigen Raum“ mit heraus. Mit ihren Engagements wollen Vina Yun und Christiane Gotz Kindern der jeweiligen zweiten Generation ein Stück weit ihre Geschichten erzählen. Für sich. Und für die Gesellschaft.
Dass das bisher kaum gemacht wurde, hat für Yun vor allem zwei Gründe. „Zum einen waren es damals vor allem Frauen, die nach Österreich migrierten“, sagt sie. Und Frauengeschichten seien oftmals jene, die marginalisiert und unsichtbar gemacht werden. Als zweiten Grund sieht sie die Erinnerungskultur in Österreich. Beziehungsweise die Lücken darin. „Migrationsgeschichte findet hier kaum Platz“, so Yun. Österreich verstehe sich bis heute nicht als Migrationsgesellschaft. Aber Migration sei vielmehr die Normalität, nicht die Ausnahme. Und die migrantischen Communitys seien genauso Teil der österreichischen Gesellschaft. „Und die Communitys würden ohne diese Frauen erst gar nicht existieren“, betont sie. Viele der damals gekommenen Frauen leben heute als Pensionistinnen in Österreich.
Auch Leonora Rayo sieht ihre Zukunft an ihrem neuen Wohnort. Sobald ihr Nostrifizierungsverfahren abgeschlossen ist, will sie ihren Sohn und ihren Ehemann auch nach Wien nachholen.
Naz Küçüktekin war bei der Wiener BezirksZeitung, dem biber Magazin, bei Profil und zuletzt beim Kurier tätig, wo sie sich im Ressort „Mehr Platz“ vor allem mit migrantischen Lebensrealitäten beschäftigte. Das tut sie nun weiterhin als freie Journalistin.
Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo



