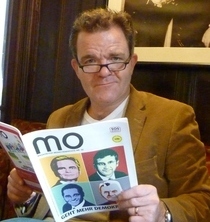Gefangen
Auf Lesbos stecken Tausende Geflüchtete auf unbestimmte Zeit fest. Es ist wie das Warten an einer aufgegebenen Bushaltestelle – kein europäisches Land will sich der Schutzbedürftigsten annehmen, man lässt die Menschen im lebensbedrohlichen Limbo zurück. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Reportage und Fotos: Franziska Grillmeier
Sie nannten sie „Mama Maryam“ oder „Die Anwältin“. Sie war die Frau mit dem ständig klingelnden Telefon und dem dunkelroten Notizbuch unter dem Arm. Für jeden erreichbar, hörte sie den Menschen im Camp von Moria bis spät in der Nacht zu. Heute, geht Maryam Janikhushk mit ihrem Telefon in eine ruhige Ecke ihrer kleinen Wohnung in der Verwaltungsstadt Mytilini, fünf Kilometer vom Flüchtlingslager entfernt. Vor einem halben Jahr siedelte das Flüchtlingshilfswerk UNHCR sie dorthin um. Schon einen Tag nach ihrer Ankunft mit dem Schlauchboot wurde sie von den älteren Afghanen im Camp zur „Community Leaderin“ in Moria gewählt. Damit war sie die erste Frau, die zwischen der afghanischen Camp-Gemeinde und der Militärverwaltung zu vermitteln versuchte. Keine einfache Aufgabe in einem von Stacheldrahtzaun und Scheinwerferlicht umzingelten Militärgebiet, das nur für 2.800 Menschen ausgelegt ist und schon vor einem Jahr mehr als die fünffache Menge Menschen fasst.
Die 41-Jährige übersetzte für PatientInnen im Krankenhaus – organisierte Milchpulver für Neugeborene, Beinprothesen für Kriegsversehrte, brachte somalische und afghanische Frauen beim gemeinsamen Brotbacken um ein Feuer, setzte die Ältesten einzelner ethnischer Gruppen unter einem Olivenbaum zusammen, um Konflikte zu schlichten, die nur allzu leicht aufgrund der Überfüllung im Camp ausbrechen. Im Laufe der Monate kommen immer mehr unbegleitete Jugendliche zu ihr, erzählen von Schlägereien, Vergewaltigungen und Alkoholismus im Camp. „Wenn die Kinder in die Schule könnten,“ sagt sie, „im Camp gibt es kaum Aufseher, sie sind hoch traumatisiert und werden immer weiter vernachlässigt.“

Aufgestauter Frust
Zu diesem Zeitpunkt, gibt es wenigstens noch ein paar Angebote für Kinder- und Jugendliche außerhalb des Lagers. Selbstorganisierter Unterricht von NGOs, ein Gym und ein Garten im Gemeinschaftszentrum „One Happy Family“ (OHF). Ein Jahr später ist das Camp isoliert. Die Schule im Gemeinschaftszentrum OHF ist durch Brandstiftung abgebrannt. Die meisten humanitären Helferinnen mussten aus Sicherheitsgründen die Insel verlassen. Seit Beginn des Jahres greifen rechtsradikale Gruppierungen immer wieder gezielt humanitäre ArbeiterInnen, ihre Häuser und Autos an. Die Gewalt ist nicht repräsentativ für die Mehrheit der Inselbevölkerung, die sich seit Jahren mit den Geflüchteten solidarisch zeigt. Und doch sind die Menschen auf der Insel müde geworden, ignoriert zu werden. Dieser aufgestaute Frust ist auch Ergebnis einer Europäischen Politik, die über die letzten Jahre hinweg bewusst die eigens auferlegten Rechtsnormen der Schutzverantwortung unbeachtet ließ.
Janikhushk’s Telefon klingelt ununterbrochen, um die „acht Stunden am Tag“, sagt sie. Die Menschen haben kaum mehr Ansprechpartner im Camp, in der Nacht sind nur zwei Polizisten für 19.000 Menschen anwesend. Die Asylbehörden haben bis Mitte Mai geschlossen. Damit können Asylsuchende nicht befragt werden und bekommen keine Entscheidungen über ihren Asylstatus. Die Zugangsstraßen zum Camp sind aufgrund der neuen Covid19-Bewegungseinschränkungen abgeriegelt. Schon zuvor trug die langwierige Bürokratie nach dem EU-Türkei Abkommen dazu bei, dass Menschen auf dem stacheldrahtumwobenen Militärgelände, teilweise über Jahre hinweg, festsaßen.
„Meine Frau ist hochschwanger, können wir bei der Geburt ins Krankenhaus?“, „Wann macht die Asylbehörde wieder auf? Wo kann meine Mutter jetzt ihre Dialyse erhalten?“ „Es gab nicht genug Essen, wo kann ich einkaufen?“, fragen zunehmend verzweifelte Stimmen. Und Maryam Janikhushk meint: „Es gibt so viel unnötiges Leid, das man verhindern könnte. Im Krankenhaus würden die Menschen nicht mehr behandelt. Die Kinder könnten nicht in die Schule gehen. Ältere Menschen mit Bewegungsschwierigkeiten würden tagelang kein Essen bekommen, da sie an den Gitterstäben der Essenausgabe schwere Verletzungen erlitten. Frauen müssten ihre Kinder im Zelt auf die Welt bringen. „Das muss man doch nach fünf Jahren regeln können?“ Doch so richtig will das keiner regeln. Vor der Pandemie nicht, und jetzt erst recht nicht. Über die Frage der Verteilung von Flüchtenden auf die Mitgliedsstaaten sind die zuständigen Innenminister der einzelnen Länder zerstritten. Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn, sowie Österreich blockieren jegliche Lösung. Deutschland, Frankreich und Luxemburg warten darauf, bis jemand den ersten Stein wirft. Und die Menschen bleiben am Saum von Europa in schwer traumatisierenden Lebensbedingungen stecken.
Deutschland erklärte sich nach langem Ringen zusammen mit anderen Europäischen Staaten, wie Luxemburg dazu bereit, 1.000 bis 1.500 kranke und psychisch belastete Flüchtlingskinder aus den überfüllten Lagern in Griechenland aufnehmen. Mitte April schafften es nur 47 Kinder und Jugendliche nach Deutschland. Sie alle standen laut „Ärzte ohne Grenzen“ nicht auf der Liste der Organisation, deren MitarbeiterInnen Namen und Daten von mehr als 150 Kindern gesammelt hatten, die wegen schwerer Erkrankungen dringend evakuiert werden mussten. Österreich schickt 180 Container auf die Inseln. Die Schweiz diskutiert weiter über die Aufnahme. Auch europaweite Petitionen, Volksbegehren und Demonstrationen beschleunigen die Aufnahme nicht. „Ich bin seit drei Jahren auf der Insel. Damals haben wir wegen der schwierigen Situation, in der 4.000 Menschen leben, Alarm geschlagen. Jetzt sind wir bei 19.000 Menschen und die Umstände haben sich seither mit jeder Woche verschlechtert,“ sagt Liza Papadimitriou, Advocacy-Managerin bei Ärzte ohne Grenzen. „Die Pandemie darf nicht dazu genutzt werden, um Menschen weiter einzusperren und ungerührt auf die Kriminalisierung von Flucht sowie auf Abschreckung zu setzen.“

Camp ist abgeriegelt
Wir sehen kaum mehr jemanden, der bei den Leuten klopft, um nachzusehen, wie es ihnen geht“, sagt Mohammad Akasis (Name geändert, Anmerkung) am Telefon. Der 38-Jährige lebt schon seit über einem Jahr in einer selbstgebauten Holzbaracke im oberen Teil der Olivenhaine. „Wir haben nicht einmal die Möglichkeit, Seife und Desinfektionsmittel zu kaufen,“ sagt er, „und aus den Leitungen kommt nur alle paar Stunden Wasser.“ Dabei ist es unmöglich, die Hygienestandards während der Pandemie einzuhalten; oder auch Menschen zu evakuieren oder zumindest die Ansteckungsgefahr im Falle eines Ausbruchs zu verringern. Dass es bisher noch zu keinem offiziellen Fall im Lager kam, grenzt an ein Wunder.
Nach Moria kommt auch Maryam Janikhushk kaum mehr. Das Camp ist seit Mitte März weitgehend abgeriegelt. Für Mitte Mai hatte man wieder eine schrittweise Öffnung geplant. „Die Solzialarbeiter sind gar nicht auf das vorbereitet, was dann auf sie zukommt“, sagt sie, „die Menschen wurden in dieser Isolierung, in der sie kaum Informationen bekommen abermals traumatisiert. Sie fühlen sich alleine gelassen, kämpfen jeden Tag ums Überleben.“ Immer wieder erzählt Janikhushk von einer 19-jährigen Frau, die am obersten Olivenhainrand von Moria lebt. Schon seit Monaten wartet sie auf eine neue Bein-Prothese. „Mit ihrem kaputten Bein braucht sie eine Stunde zur Toilette und zurück. Dabei wäre es doch ein einfacher Schritt, Menschen mit Behinderung nahe an der Essensausgabe oder Toilette unterzubringen“, sagt sie. „Der Weg ist uns abgeschnitten. Vorne und hinten. Es geht immer im Kreis, wie auf dieser Insel.“
Franziska Grillmeier ist freie Journalistin und lebt seit Sommer 2018 auf Lesbos. Dort verfolgt sie vor allem die Lebenslinien einzelner Menschen und analysiert die politischen Hintergründe zur andauernden Krise.
Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo