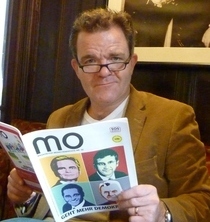„Man darf nicht schweigen“
Im Alter von sieben Jahren hat Gerda Frey gemeinsam mit ihren Eltern in einem Versteck in Budapest die Shoa überlebt. Erinnerungen einer bemerkenswerten Frau. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Interview: Eva Bachinger, Fotos: Karin Wasner
Gerda Frey steht am Fenster und schiebt die weißen Gardinen zur Seite: “Die Aussicht ist von meiner Wohnung aus wunderbar. Das müssen Sie sehen! Man sieht drei Kirchen, den Stephansdom, die Dominikanerkirche und die Jesuitenkirche.” Heute kann sie am Fenster so lange bleiben wie sie will. 1944 trat sie in einer kleinen Wohnung in Budapest ebenfalls ans Fenster, weil die Sonne so schön strahlte und Kinderlachen vom Spielplatz unten im Park zu hören war. Doch ihre Eltern zogen sie sofort zurück, damit sie nicht gesehen wird. Die damals siebenjährige Gerda musste im März 1944 mit ihren Eltern Lili und Ernö in ein Versteck um der Deportation zu entgehen. Der Bäcker Franko Dezsö war ein alter Freund von Ernö aus Jugendzeiten. Er überredete seine Frau, die Familie unter Lebensgefahr in ihrer Wohnung zu verstecken. Neun Monate lang verbrachten sie in einem kleinen Raum. „Die Angst entdeckt zu werden war immer da. Obwohl ich ein Kind war, war mir bewusst, dass wir in Lebensgefahr schwebten“, erzählt die heute 83-jährige Dame in ihrer geräumigen Wiener Wohnung.

Die Abschiebung nach Ungarn 1943 hat Gerda letztlich vor Auschwitz bewahrt.
Der 19. März ist ein Datum, das sich in ihr Gedächtnis eingebrannt hat: Hitlers Truppen besetzten Ungarn. Als im März 2020 wegen der Corona-Pandemie in Österreich ein umfassender Lockdown von der österreichischen Regierung verordnet wurde, erinnerte sie sich besonders gut an diese Zeit, isoliert in einem kleinen Zimmer. Um den Menschen, die nun alle zuhause bleiben sollten, Mut zu machen, schrieb sie einen Leserbrief, der im „Standard“ veröffentlicht wurde. Sie wollte keine weitere Holocaust-Geschichte anfügen, erklärt sie, sondern aufzeigen, wie man unter schwierigsten Umständen einem Kind die Realität erklären und es trotzdem bei Laune halten kann. Ihren Eltern sei das gelungen: “Wir haben viel gelesen, ich habe ungarische Gedichte gelernt, gezeichnet und Rätsel gelöst. Es gab kein Radio, kein Fernsehen und kein Internet. Ich hatte nur eine Puppe, meine Mutter hat ihr Kleider genäht, mein Vater erzählte mir Geschichten aus der Bibel und erklärte mir die Welt. Wir konnten nur miteinander flüstern, durften untertags keinerlei Lärm machen. Aber ich war von meinen Eltern umgeben und von Liebe, was vielen nicht gegeben war.“ Viele Reaktionen erreichten Gerda Frey, die meisten positiv. „Viele Mütter haben sich gemeldet, ein Familienvater hat mir geschrieben, dass er sich den Leserbrief ausgedruckt und eingerahmt hat,“ freut sie sich.

Versteck in Budapest. „Wir konnten nur miteinander flüstern, durften keinen Lärm machen.“
Gerda Frey, geborene Brandl, kam 1936 in Wien auf die Welt. Ihre zwei ersten Lebensjahre verbrachte sie in Mattersburg, wo es eine große jüdische Gemeinde gab. Wegen des Suizids seines Bruders übernahm ihr Vater das alteingesessene, angesehene Textilgeschäft Brandl in Mattersburg und gab den Arztberuf auf. Doch dann kam der Anschluss 1938. Lili Brandl musste innerhalb weniger Tage das Haus verlassen und flüchtete mit dem Baby zu ihrer Schwägerin in Wien. Ernö wurde sofort verhaftet: “Als er nach sechs Wochen freigelassen wurde, hat meine Mutter ihn nicht wiedererkannt, kaum Zähne, ein geschwollenes Gesicht, grün und blau geschlagen.” Die kleine Familiesuchte Zuflucht bei den Großeltern in Ungvár in der damaligen Tschechoslowakei. Doch die Odyssee ging weiter: 1942 wurden die Eltern nach Budapest abgeschoben und kamen in das Internierungslager Szabolcsutca, auch Gerda wurde 1943 abgeschoben. „Das hat mich schlussendlich vor Ausschwitz bewahrt“, meint sie heute. 1944 gelang den Eltern die Flucht. In Budapest war die Familie wieder vereint, monatelang in einem abgedunkelten Zimmer.
Als im November 1944 die Bombardements begannen, brachte Franko sie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion zu einem Unterschlupf hinter der Bäckerei, wo die Bedingungen noch schlechter waren. Am 24. Dezember 1944 machte sich Ernö auf die Suche nach einer neuen Bleibe. Sie gaben sich als christliche Geflüchtete aus und lebten mit einer Familie in einer kleinen Wohnung. „Wenn ich an diese Zeit denke, kommen traumatische Bilder hoch: Als ich beim Fenster hinausgeschaut habe, sah ich Leichen in der Donau treiben. Das Mädchen der anderen Familie meinte nur, mach dir nichts draus, das sind nur Juden. Hohe Häuser brannten lichterloh, das war sehr bedrohlich.“ Die Familie suchte nach Kriegsende zunächst ihre Verwandten in Ungvár, doch da war nur noch ein Neffe. 54 Angehörige, auch die Großeltern waren ermordet worden. Sie reisten weiter nach Mattersburg. „Ich sehe uns heute noch am Bahnsteig, mit einem kleinen Koffer. Wir gingen zu unserem Haus, wo die russische Kommandantur residierte. Sie quartierten uns bei einer Familie ein, die früher Nazis waren. Aber sogar mit dieser Familie haben sich meine Eltern angefreundet.“ Als die Russen weg waren, konnten die Brandls wieder in ihr Haus und haben sogar das Geschäft wiedereröffnet. „Ich konnte kein Wort Deutsch, aber Kinder lernen schnell. Doch Mutter tat sich besonders schwer, weil sie die ganze Familie verloren hatte.“
Gerda Frey war jung und wollte in die Welt hinaus. Als 17-Jährige bekam sie durch ein Stipendium die Möglichkeit ein Jahr in Syracuse eine High-School zu besuchen und bei einer Gastfamilie zu wohnen. Diese Zeit in den USA hat sie tief geprägt: „Das hat mir einen Weitblick und Weltblick verschafft. Meine Eltern waren weltoffen und gebildet, aber sie waren so gerädert und gezeichnet von all den schweren Jahren, das leichte Leben kannte ich nicht. Und dann kam ich in eine fröhliche Familie mit vier Söhnen und lernte es kennen.“ Zurück in Wien begann sie ein Medizinstudium, das sie aber bald aufgab, als ihr ein Job in der US-Botschaft angeboten wurde. „Das war damals eine große Auszeichnung“, trotzdem blieb sie nur kurz, weil sie ihrem späteren Ehemann begegnet war. Mit ihm hat sie drei Söhne, einer von ihnen ist Eric Frey, Journalist bei „Der Standard“. Der Ältere lebt in den USA, die ganze Familie kommt einmal jährlich in Jesolo, Italien zusammen. Ihr und ihrem Mann sei wichtig gewesen den Kindern den Glauben an die Menschlichkeit trotz allem mitzugeben. „Man kann nicht mit Hass und Misstrauen durchs Leben gehen. Ich schweige nicht, wenn ich Ungerechtigkeit sehe, zum Beispiel, wenn ein Bettler angepöbelt wird. ‚Warum machen Sie das’, frage ich. Dann kommt oft eine Hasstirade auf Roma und Ausländer, aber ich finde, man darf nicht schweigen.“

Ein Onkel von Gerda Frey war Künstler, er hat einige Porträts von ihr gemalt.
Vor zwölf Jahren starb Gerda Frey’s Mann. „Ich war 50 Jahre glücklich verheiratet. Das Alleinbleiben nach dem Tod meines Mannes war sehr schwer, das Alleinsein zu Corona-Zeiten war kein Problem für mich.“ Bis 1965 arbeitete sie als Übersee-Repräsentantin des „American Field Service“, das ihr damals das Stipendium ermöglicht hatte. Ab 1979 war sie Repräsentantin des „International Council of Jewish Women“ bei der UNO in Wien.
Bei der jährlichen Veranstaltung der Bundesregierung zum Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus am 8. Mai war 2019 auch Gerda Frey als Zeitzeugin geladen. Sie appellierte: „Trennt nicht die Menschen in ‚Wir’ und ‚die Anderen’. Ich habe zu den anderen gehört und ich weiß, was das bedeutet. Es kann jedem passieren, dass man einmal als der andere abgestempelt wird“. Sie zeigte ein Kindergartenfoto aus Ungvár, 1942: Darauf sind 33 Kinder im Sonntagsstaat mit einer Betreuerin zu sehen. „Ich habe die Kinder beneidet, weil sie im Gegensatz zu mir noch mit ihren Eltern vereint waren. Das verfolgt mich bis heute“, denn keines dieser Kinder habe überlebt, nur sie, Gerda. Dieses Bild zeigte sie auch bei ihren vielen Besuchen in Schulen, oder sie nahm ein altes, abgegriffenes Fotoalbum ihrer Großmutter mit und erzählte von der Auslöschung ihrer Verwandten, versuchte das Unbegreifliche an konkreten Menschen begreiflich zu machen. Gerda Frey ist eine offene, neugierige, lebensfrohe Frau und schaut optimistisch in die Zukunft. Das Auswendiglernen von Texten hat sich bewährt: Zum Abschied zitiert sie den ungarischen Autor Imre Madách: “Ember küzdj és bízva bízzál“, übersetzt: „Mensch kämpfe – im Sinne von strebe, bemühe dich - und vertraue.“
Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo