
Dr. McMillan: „Migrant*innen dauerhaft vom Wahlrecht auszuschließen ist undemokratisch"
Die neuseeländische Politikwissenschaftlerin Dr. Kate McMillan gibt spannende Einblicke in die Erfahrungen Neuseelands mit einem Wahlrecht, für das der Pass relativ egal ist. Sie hält es „für eine gute Idee“, dass alle, die dauerhaft in einem Land leben, „ein Recht haben, an der Entscheidungsfindung dieses Landes teilzuhaben“. Im Folgenden ihr Statement zur Pass Egal Wahl von SOS Mitmensch:
Neuseeländisches Wahlrecht
„Gemäß neuseeländischem Wahlgesetz hat jede*r mit ständigem Wohnsitz in Neuseeland nach einjährigem Aufenthalt das Wahlrecht, wenn sie/er über 18 Jahre alt ist und die anderen Wahlkriterien erfüllt. Die Hauptfrage ist also, wie „ständiger Wohnsitz“ definiert wird. Daher müssen wir uns das Einwanderungsgesetz ansehen, wo „ständiger Wohnsitz“ etwas anderes bedeutet als im Wahlgesetz. Es gibt ein Visum mit dem Namen „Permanent Resident Visa“, dieses ist aber nicht unbedingt nötig um nach dem Wahlgesetz als ständige*r Einwohner*in Neuseelands zu gelten. Zusammengefasst: jede*r mit einem Visum, das keine Ausreise zu einem bestimmten Datum erfordert, kann wählen. Auch abseits vom Wahlrecht gibt es sehr wenige Differenzierungen zwischen ständigen Einwohner*innen und Staatsbürger*innen, aber es gibt Ausnahmen: z.B. können nur Staatsbürger*innen für das Parlament kandidieren oder Teil der „All-Blacks“ (Anm.: Rugby-Nationalmannschaft) werden.
Demokratische Partizipation ganz oben auf der politischen Agenda Neuseelands
Weltweit sehen wir den Trend, dass Wahlrechte zunehmend gefährdet sind, zum Beispiel in den USA. Die neuseeländischen Wahlgesetze sind sehr liberal und entgegen zum globalen Trend wurde auch in letzter Zeit einiges dafür getan die Stimmabgabe so einfach wie möglich zu gestalten. Zum Beispiel wurde die Frist zur Wahlregistrierung bis zum Wahltag ausgedehnt, Möglichkeiten zur vorzeitigen Stimmabgabe ausgeweitet und es gibt überall Wahlkabinen, wie in Supermärkten, Universitäten, Kirchen oder Schulen. In der Vergangenheit mussten die Menschen am Wahltag wählen und dafür zu ihrem örtlichen Gemeindezentrum gehen, heutzutage ist die Stimmabgabe viel einfacher geworden.
Geschichte des neuseeländischen Wahlrechts
Neuseeland hat eine lange Geschichte als Pionier in Bezug auf die Inklusivität seiner Demokratie. Es war das erste Land, das 1891 aufhörte, Frauen das Wahlrecht zu verweigern. In Bezug auf das Wahlrecht für Migrant*innen ist es wichtig, den historischen Kontext zu verstehen, in dem es entstanden ist. Neuseeland war eine britische Kolonie und wurde hauptsächlich von Einwanderer*innen aus Großbritannien besiedelt. Bis in die 1960er Jahre waren etwa 95 Prozent der Bevölkerung britische Migrant*innen, deren Nachkommen oder indigene Māori. Erst 1948 wurde die neuseeländische Staatsbürgerschaft eingeführt, bis dahin hatte jeder in Neuseeland den Status eines „britischen Subjekts“ – genauso wie Menschen in u.a. Australien, Kanada oder Südafrika. Selbst nach Einführung der Staatsbürgerschaft waren die meisten Menschen weiterhin nicht nur neuseeländische, sondern auch britische Staatsbürger*innen. Unser Wahlgesetz zog bis in die 1970er-Jahre die britische Staatsangehörigkeit als Wahlrechts-Kriterium heran. In den 1970er-Jahren wurde die Diskussion durch Entwicklungen in Australien und Kanada angestoßen, wo das Wahlrechts-Kriterium „britisches Subjekt“ durch die jeweilige Staatsbürgerschaft dieser Länder ersetzt wurde. Dagegen gab es in Neuseeland große Bedenken: viele Brit*innen haben sich nie die Mühe gemacht die neuseeländische Staatsbürgerschaft anzunehmen und wären dadurch vom Wahlrecht ausgeschlossen. In Bezug auf diese Bedenken wurde ein Komitee eingesetzt, das empfahl für den Moment das Wahlrecht nicht auf neuseeländische Staatsbürger*innen einzuschränken. Also wurde im Wesentlichen nur das Kriterium „britisches Subjekt“ aus dem Wahlrecht herausgenommen, und andere Kriterien wie ein einjähriger Aufenthalt, die Altersgrenze und so weiter so belassen, wie sie waren. Das Thema wurde damals nicht viel diskutiert, da es von einer anderen und viel umstritteneren Wahlrechtsreform bezüglich der indigenen Māori überlagert wurde. Die neuseeländischen Gesetze zur inklusiven Stimmabgabe wurden weder damals noch später kontrovers diskutiert oder in Frage gestellt. Wenn es Debatten über unsere Wahlgesetze gab, dann umgekehrt zur Frage ob es fair sei, dass man Staatsbürger*in sein muss, um für das Parlament zu kandidieren – was etwa 1986 im Rahmen einer königlichen Kommission zur Evaluierung des neuseeländischen Wahlrechts diskutiert wurde. Obwohl die Einführung des Wahlrechts für nicht-neuseeländische Staatsbürger*innen also nicht durch eine besonders inklusive oder liberale politische Kultur motiviert war, spielt diese Kultur dennoch eine wichtige Rolle für seine weitgehend unangefochtene Beibehaltung.
Auswirkung des liberalen Wahlrechts auf die Einbürgerungsmotivation
Es mag sein, dass die geringe Differenzierung zwischen ständigen Einwohner*innen und Staatsbürger*innen bei einigen Gruppen, z. B. Brit*innen, zu niedrigen Einbürgerungsraten führt. Wenn andererseits die Staatsbürgerschaft aber zur Bedingung gemacht wird, um wählen zu dürfen oder ein*e z.B. „echte*r Österreicher*in“ zu sein, dann werden die Leute viel instrumenteller und transaktionaler in der Art und Weise sein, wie sie die Staatsbürgerschaft sehen. Einer meiner Student*innen, Pavithra Jayawardena, verglich Menschen aus Sri Lanka, die nach Neuseeland kamen, mit jenen, die nach Australien gingen, wo die Einbürgerung schwieriger und auch viel wichtiger ist, um gewisse Rechte zu bekommen. Eine Schlussfolgerung ihrer Forschung war, dass die Motivation zur Einbürgerung in Australien im Vergleich zu Neuseeland viel häufiger in den damit verbundenen Rechten liegt, und weniger oft in der Liebe und positiven Beziehung zum Land. Menschen, die sich in Neuseeland einbürgern lassen, tun das öfter vor allem aus persönlicher Überzeugung und um Loyalität mit diesem Land zu demonstrieren. Es gibt aber auch einige praktische Vorteile, die die neuseeländische Staatsbürgerschaft mit sich bringt, wie das passive Wahlrecht oder einen starken Reisepass. Ein Aspekt, der in diesem Kontext berücksichtigt werden muss, ist, dass die wichtigsten Herkunftsländer von Einwanderer*innen nach Neuseeland China und Indien sind, die keine doppelte Staatsbürgerschaft zulassen. Wenn Neuseeland also die Staatsbürgerschaft zum Wahlkriterium machen würde, würde dies Menschen bevorzugen, deren Herkunftsländer die doppelte Staatsbürgerschaft zulassen. Andere würden schlechter gestellt und müssten sich zwischen dem Wahlrecht in Neuseeland und ihrer ursprünglichen Staatsbürgerschaft entscheiden. Die Abgabe ihrer ursprünglichen Staatsbürgerschaft kann Migrant*innen Probleme bereiten und es z.B. erschweren, ihre alten Länder zu besuchen und dortige familiäre und andere Beziehungen aufrechtzuerhalten.
Politische Integration
Die Tatsache, dass sie wahlberechtigt sind, fördert die politische Integration von Migrant*innen, wobei das ziemlich schwer zu messen ist. Andererseits bedeutet es nicht, dass alle Migrant*innen auch an Wahlen teilnehmen – auch wenn es wichtige positive Gefühle auslöst, theoretisch wählen zu können, ist die Wahlbeteiligung einiger Migrationsgruppen immer noch recht niedrig. Wir sehen das zum Beispiel bei chinesischen Migrant*innen, insbesondere bei jenen aus Festlandchina, die oft keine Erfahrung damit haben wählen zu gehen. Während es schwierig ist, die Auswirkungen des Wahlrechts auf die politische Integration umfassend zu analysieren, kann jedenfalls gesagt werden, dass es die politischen Parteien dazu motiviert sich auch um die Stimmen von Migrant*innen zu bemühen. Wenn der Großteil der migrantischen Bevölkerung wahlberechtigt ist, wird es für migrationsfeindliche Parteien natürlich schwieriger. Migrant*innen und ihre Anliegen können nicht ignoriert werden und sie fühlen sich auch häufiger zur Beteiligung an politischen Debatten ermächtigt. Es gibt in Neuseeland zum Beispiel sehr starke indische Medien, und wenn die sehen, dass in der Politik etwas passiert, das ihre Interessen betrifft, fühlen sie sich auch ermächtigt, ihre Stimme zu erheben.
Neuseeland ist kein Migrant*innen-Paradies
Andererseits ist Neuseeland auch nicht jenes Paradies für Migrant*innen, als dass es von außen manchmal erscheinen mag. Wie in anderen Ländern haben auch wir verschiedene befristete Visa eingeführt, mit denen Menschen zwar zum Beispiel in der Landwirtschaft, Altenheimen oder auf Baustellen arbeiten können, aber keinen dauerhaften Aufenthalt erhalten. Dadurch wächst auch in Neuseeland der Anteil jener Menschen, die schon längere Zeit hier leben, aber immer noch nicht wahlberechtigt sind. In Bezug auf die politischen Parteien kann man sagen, dass wir eine öffentliche politische Kultur haben, in der rassistische Aussagen inakzeptabel sind. Politiker*innen, wie sie es z.B. in den rechtsextremen Parteien Österreichs gibt, würden in der Öffentlichkeit sehr negativ wahrgenommen werden, was nicht heißt, dass dies nicht auch hier passieren könnte. Neuseeland hat ein sehr hohes Maß an Einwanderung erlebt, was in vielerlei Hinsicht sehr positiv war. Aber es gibt auch viel tiefen und extremen Rassismus, der von vielen Māori ebenso erlebt wird wie von chinesischen oder anderen asiatischen Migrant*innen. Aber zumindest in öffentlichen Debatten, d.h. in den Medien, wird Rassismus nicht toleriert. Wenn Politiker*innen etwas explizit Rassistisches sagen würden, würde das scharf zurückgewiesen werden, zumindest aktuell. Unter anderem aus geografischen Gründen sind wir ein sehr isoliertes Land, wo einige Dinge anders und manchmal besser laufen, manchmal aber auch nur durch Glück.
Der Wahlausschluss von Nicht-Staatsbürger*innen ist undemokratisch
Zusammenfassend sind die Hauptargumente für das Wahlrecht von Nicht-Staatsbürger*innen recht einfach. Es ist eine gute Idee, dass alle, die dauerhaft in einem Land leben und den Gesetzen dieses Landes unterliegen, ein Recht haben, an der Entscheidungsfindung dieses Landes teilzuhaben. Dieses Recht muss nicht sofort gegeben sein, aber zumindest wenige Jahre nach Ankunft im Land. Migrant*innen dauerhaft vom Wahlrecht in ihrem Wohnsitzland auszuschließen, ist undemokratisch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die politische Partizipation von Migrant*innen zu erleichtern. Eine Möglichkeit besteht darin, einen Weg zur Staatsbürgerschaft zu schaffen, der es Daueransässigen ermöglicht, sich innerhalb eines angemessenen Zeitraums einbürgern zu lassen. Wie lange dieser Zeitraum sein sollte, kann debattiert werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, wie Neuseeland Nicht-Staatsbürger*innen mit ständigem Wohnsitz im Land die Teilnahme an nationalen Wahlen zu gestatten. Die Erfahrung Neuseelands ist, dass es bisher keine Probleme mit dem Wahlrecht für von Nicht-Staatsbürger*innen gab, zumindest keine Probleme, die nicht auch beim Wahlrecht für Staatsbürger*innen auftreten könnten.“
Übersetzung durch SOS Mitmensch, das englischsprachige Original kann HIER heruntergeladen werden.
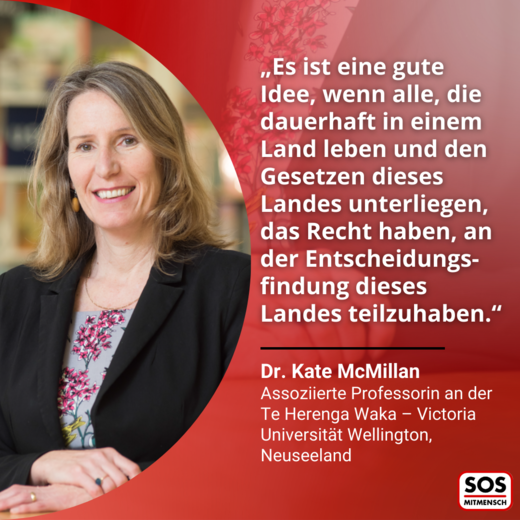
Jetzt den SOS Mitmensch Newsletter abonnieren
Ermöglichen Sie mit einer Spende unsere weitere Menschenrechtsarbeit


