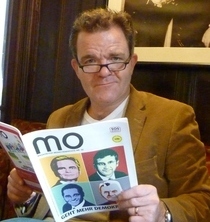„Nie wieder diesen Schmerz spüren“
Stärke demonstrieren, aber niemals Gefühle zeigen: Noch immer prägt diese Formel unsere Vorstellung von Männlichkeit. Ein Gespräch mit der Soziologin Laura Wiesböck über toxische Männlichkeit, Frauenhass und fragile Emanzipationszugewinne. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Interview: Brigitte Theißl, Fotos: Karin Wasner
Über „toxische Männlichkeit“ wurde zuletzt im Zuge der MeToo-Bewegung heftig debattiert. Was zeichnet denn eine „giftige“ Männlichkeit aus?
Innerhalb dieses Männlichkeitsbilds gibt es keinen Raum und keine Sprache für Verletzlichkeit. Schmerz, Leid und Angst werden im Inneren verdrängt und im Außen bekämpft. Anstatt sich selbst verletzlich zu zeigen, verletzt man andere. Kontrolle ist ein zentrales Element der toxischen Männlichkeit. Es gibt Studien zu Pick-up-Artists, die mithilfe von manipulativen Strategien sexuelle Erfahrungen sammeln wollen. Viele geben an, Ablehnungen oder Trennungen erlebt zu haben, die für sie sehr schmerzhaft waren. Und diesen Schmerz wollen sie nie wieder spüren, da er einen Verlust von Kontrolle darstellt – und damit auch einen gefühlten Verlust von Männlichkeit. Das ist ein Kern des Frauenhasses in diesem Männlichkeitsbild: Frauen können verletzlich machen und einem die emotionale Souveränität nehmen. Auch deshalb sind Trennungen eine der gefährlichsten Zeiten für Frauen. Diese toxischen Männlichkeitsbilder sind für Frauen sehr beschädigend, aber auch für Männer selbst. Denn sie gehen mit einer starken emotionalen Einsamkeit einher.
Der Begriff der toxischen Männlichkeit polarisiert. KritikerInnen monieren, er würde Männer pauschal verunglimpfen.
Erst einmal muss betont werden, dass dieses Männlichkeitsprinzip nicht mit Männern gleichzusetzen ist. Das ist ein häufiges Missverständnis. Der Kritik an diesem Prinzip liegt ja eben genau kein „schlechtes“ Männerbild zugrunde, etwa dass Männer hormonell und biologisch bedingt aggressiver seien und man nichts dagegen machen kann. Kritisiert wird, dass das Männlichkeitsprinzip auf Überragung und Machtausübung basiert. Dieses aufzubrechen würde einem emotional erfüllenden Leben zuträglich sein. Auf gefühlte Kränkungen mit Hass und Aggression zu reagieren, verunmöglicht ein würdevolles Leben. Es ist allerdings ein zäher Prozess, denn Menschen, die ohne eigenes Zutun in Machtstrukturen privilegiert sind, haben meist wenig Interesse daran, das zu ändern.

„Je höher die Emanzipationsgewinne von Frauen, desto plakativer die Männlichkeitsbilder.“ Laura Wiesböck
Die Männlichkeitsforschung widmet sich seit Jahrzehnten dem „neuen Mann“. Mit Blick auf die sozialwissenschaftliche Forschung: Wie haben sich die Einstellungen von Männern verändert, aber auch die Erwartungen, die an sie herangetragen werden?
Grob heruntergebrochen kann man sagen: Je höher die Emanzipationsgewinne von Frauen, desto plakativer die Männlichkeitsbilder. Das sieht man zum Beispiel an der Darstellung von Waffen und Männerkörpern in Mainstream-Filmen, wie es Jackson Katz beschreibt. In Gangsterfilmen der 1960er-Jahre waren es noch handliche Pistolen, in den 1990ern sieht man einen überdimensional muskulösen Terminator mit einer 40 Kilo schweren vollautomatischen Schusswaffe. Das männliche Prinzip der Überragung wird heute stärker über den Körper repräsentiert, mitunter da es weniger über andere Bereiche ausgelebt werden kann, wie in der Rolle des alleinverdienenden Versorgers. Hinter der Ausdifferenzierung von Geschlechterrollenbilder im Mainstream stehen auch konsumkapitalistische Interessen. Als ich ein Kind war, gab es für Babys in großen Kleidungsgeschäften Strampler in bunten Farben. Heute finden sich für Buben Military- und Totenkopf-Motive, für Mädchen pinke Prinzessinnenkleider. Man kann also auf verschiedenen Ebenen eine Zuspitzung dieser Geschlechterrollenbilder erkennen.
Vor einigen Jahren beklagte die deutsche Journalistin Nina Pauer in der „Zeit“ sogenannte Schmerzensmänner, die sehr emotional und Frauen gegenüber zu zögerlich und unsicher wären. Stehen dem Aufbrechen patriarchaler Männlichkeitsbilder auch Frauen im Weg?
Auch, ja. Patriarchat wird oft gleichgesetzt mit „Männer“, aber das ist nicht zutreffend. Im Patriarchat sind jene erfolgreicher, die die ungleiche Verteilung von Macht und Privilegien zwischen Männern und Frauen nicht angreifen. Wenn wir uns Verpartnerungen anschauen, streben Frauen in heterosexuellen Paarbeziehungen weiterhin häufig nach dem Prinzip der männlichen Überragung. Das betrifft die Körpergröße, aber auch Status, Einkommen, den beruflichen Erfolg. Das Prinzip der Überragung ist für Männer essentiell, die ein fragiles Männlichkeitsgefühl in Sicherheit halten müssen. Eine Partnerin auf Augenhöhe oder eine, die vielleicht erfolgreicher ist oder mehr Lebenserfahrung hat, wird als Bedrohung wahrgenommen, als Verlust einer Machtposition.
Nicht nur Pick-up Artists, auch andere frauenfeindliche Gruppen haben in den vergangenen Jahren im Netz für Aufsehen gesorgt: etwa „Incels“, die „unfreiwillig zölibatär“ leben und darauf mit Frauenhass reagieren. Es fällt auf, dass dies meist weiße Mittelschichtsmänner sind. Welche Rolle spielen Klasse und Race bei der toxischen Männlichkeit?
Ein Erklärungsansatz ist, dass es jene Mitglieder der Gesellschaft sind, die eine privilegierte Vormachtstellung haben, die leicht zu bröckeln beginnt. Und die eine starke Anspruchshaltung haben auf Flirten, Sexualität, Beziehung. Daraus wird das Recht abgeleitet, diesen Anspruch auch mit Gewalt herzustellen. Oft wird davon gesprochen, dass „der Feminismus“ Beziehungen zerstören würde. Beziehungen waren aber immer schon häufig dysfunktional, nur werden sie heute eher getrennt oder erst gar nicht eingegangen. Das basiert auf den Emanzipationsgewinnen von Frauen. Es werden also weniger Beziehungen zerstört, als zerstörte Beziehungen beendet.

„Machokulturen“, die importiert wurden (Sebastian Kurz). Laut Laura Wiesböck eine Rhetorik, mit der gesellschaftliche Probleme ausgelagert werden sollen.
Es gibt aber auch positive Entwicklungen. Vor 30 Jahren wurde ein Vater mit Baby auf dem Arm noch schief angesehen, heute fällt das im Stadtbild nicht mehr auf.
Definitiv gibt es auch zuträgliche Entwicklungen wie diese. Man muss aber dazusagen, dass das auf bestimmte Milieus zutrifft. Auch am Arbeitsmarkt und in anderen Lebensbereichen gibt es emanzipatorische Zugewinne für Frauen, gleichzeitig sind diese sehr fragil. In europäischen Demokratien, die rechtspopulistische Mehrheiten haben, wird versucht, hart erkämpfte Frauenrechte wieder zu beschneiden. Polen hat erst kürzlich die Gebärpflicht für Schwangere eingeführt. Und positive Entwicklungen muss man auch genauer betrachten. Frauen partizipieren zum Beispiel stärker am Arbeitsmarkt, aber nicht, weil die unbezahlte Arbeit unter den Geschlechtern gleichmäßiger verteilt wird. Diese wird weiterhin und zusätzlich von Frauen ausgeführt oder auf weniger privilegierte Frauen ausgelagert.
Politische Kampagnen werben seit Jahren für die Väterkarenz. Dennoch sind nur rund vier Prozent der Kindergeld-BezieherInnen Männer, der Wert ist zuletzt sogar gesunken.
Väterkarenz ist ein wichtiges Thema und auch relativ komplex, denn da spielen viele Faktoren eine Rolle. In Österreich haben wir ein wohlfahrtstaatliches Modell, das sich am männlichen Ernährer-Modell orientiert. De facto verdienen Männer weiterhin mehr als Frauen, auf der Haushaltsebene ist es für viele - rein ökonomisch betrachtet - sinnvoll, das höchstmögliche Einkommen zu erzielen. Zusätzlich sind traditionelle Geschlechterrollenbilder hierzulande sehr stark verankert. Das äußert sich in der geringen Verantwortungshaltung von Vätern, der Betreuung ihrer Kinder nachzukommen. Aber das zeigt sich auch am Arbeitsplatz. Mir selbst sind Fälle bekannt, wo junge Männer ihre Chefs nach Karenz gefragt haben und diese sie als unmännlich abgewertet haben. Da fallen Sätze wie „Haben Sie leicht eine Karrierefrau zuhause?“ Insgesamt wird die Väterkarenz in Österreich politisch auch nicht forciert.
Die österreichische Regierung verortet patriarchale Männlichkeitsbilder gerne bei zugewanderten Menschen. Kanzler Kurz sprach im Jänner von „Machokulturen“, die teilweise importiert worden seien.
Eine Rhetorik, die wirksam ist, um gesellschaftliche Probleme auszulagern und sich nicht mehr damit auseinandersetzen zu müssen. Frauenrechte werden von rechtskonservativen Parteien nahezu ausschließlich im Kontext von rassistischer Instrumentalisierung thematisiert. Da geht es um das Hochhalten von rechten Werten und patriarchalen Besitzverhältnissen, „bei uns gibt es sowas nicht“ oder lasst „unsere Frauen“ in Ruhe. Femizide sind politisch meist nur dann ein Thema, wenn der Täter Migrationshintergrund hatte. Für die Mobilisierung mancher Wählerstimmen mag das wirksam sein, von Gewalt betroffenen Frauen bringt das nichts.
Rechte Parteien feiern vielerorts Wahlsiege. Der Wunsch nach „starken Männern“ und Führern ist auch in Österreich erschreckend stark ausgeprägt, wie eine Umfrage zeigte.
Wir haben auch bei den vergangenen Wahlen gesehen, dass Männer zu einem höheren Anteil Parteien wählen, die patriarchale Männlichkeitsbilder, autoritäre Neigungen und die Abwertung von benachteiligten Gruppen verkörpern. Hinter einer Identität, die sich an Macht und Autorität orientiert, liegt oft ein Gefühl der Minderwertigkeit, das durch das Gehabe von männlicher Stärke versucht wird zu kompensieren. Frauen haben dieses Bedürfnis weniger, unter anderem, weil sie ihre Verletzlichkeit eher ausleben und weniger in Form von Hass kanalisieren. Insgesamt haben autoritäre Tendenzen jedoch vielschichtige Hintergründe und sind ein brennendes Problem für westliche Demokratien. Das würde ich sehr ernst nehmen.
Laura Wiesböck ist Soziologin mit Forschungsschwerpunkt auf sozialer Ungleichheit mit besonderem Fokus auf Arbeit, Armut und Geschlecht.
Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo