
Expert*innen zu humanitärer Aufnahme - Prof. Sieglinde Rosenberger
"Humanitäre Aufnahmeprogramme ermöglichen reguläre Wege der Zuwanderung aufgrund von internationalem Schutz." - Prof. Sieglinde Rosenberger ist als Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Wien tätig. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem in den Bereichen Migration, Asyl, Integration, Demokratie und dem österreichische politischen System.
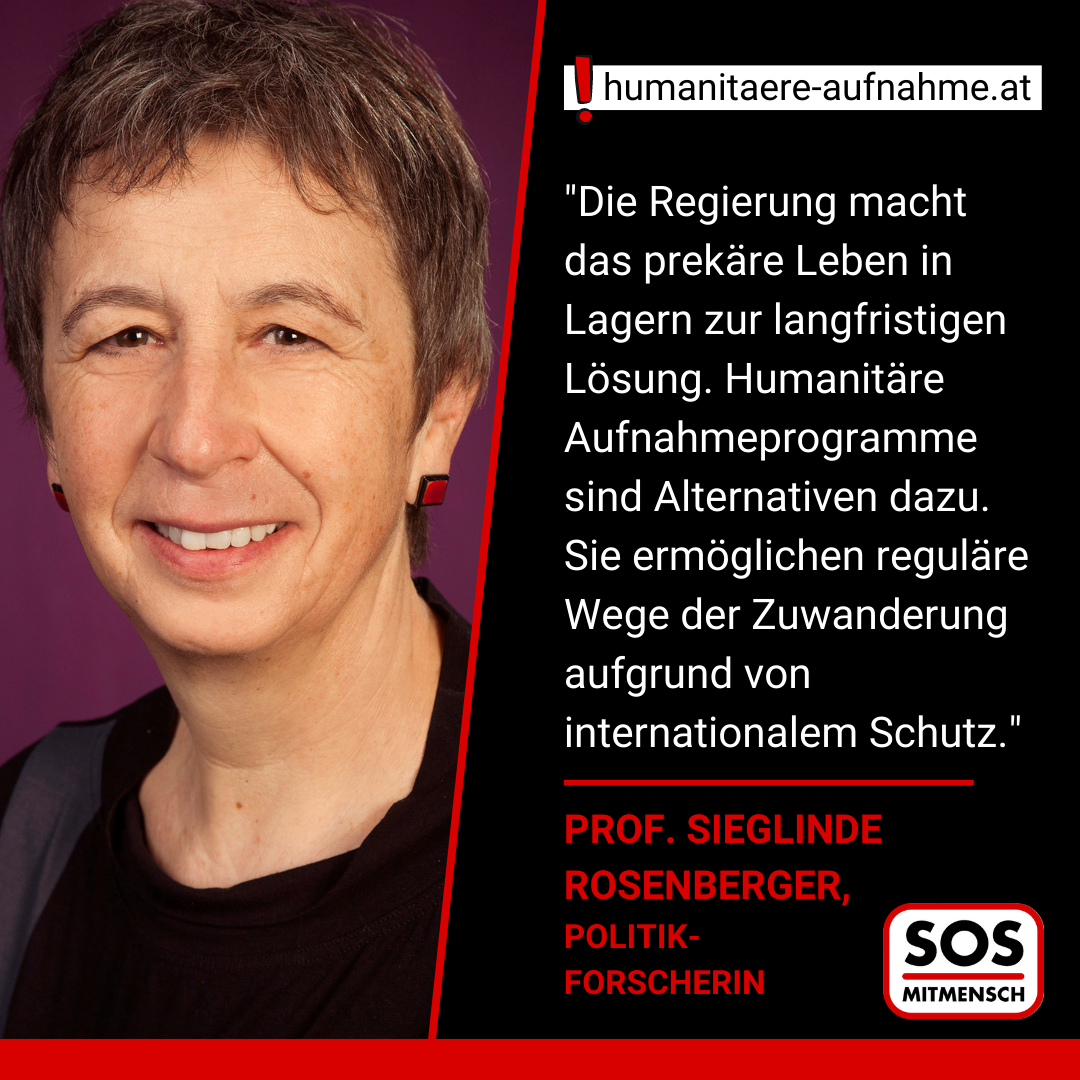
"Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs gilt das Interesse der österreichischen Asyl- und Grenzpolitik der Bekämpfung der irregulären Migration. Aus einem nationalstaatlichen Blickwinkel ist das Steuerungsinteresse verständlich und nachvollziehbar. Dennoch, wer gegen irreguläre Zuwanderung auftritt, sollte gleichzeitig aktiv für reguläre Wege eintreten. Wenn dies nicht passiert, läuft die Rede der Bekämpfung von irregulärer Migration auf Schließung und Verweigerung von Schutz hinaus.
Keine humanitäre Aufnahme in Österreich
Seit 2018 lehnt die österreichische Bundesregierung jegliche Aufnahme von Geflüchteten über humanitäre Programme strikt ab. Dies war nicht immer so. Zwischen 1992 und 1995 kamen ca. 90.000 Menschen als sogenannte Kontingentsflüchtlinge aus Bosnien und Herzegowina nach Österreich. Kontingentsflüchtlinge werden aufgenommen, ohne ein individuelles Asylverfahren durchzuführen.
Resettlement vs. Relocation
In jüngerer Zeit sind Resettlement- und Relocation-Programme reguläre Zuwanderungswege im Bereich von Flucht und Asyl. Der UNHCR spricht von Resettlement, wenn Flüchtlinge in Kriesengebieten ausgewählt und dauerhaft in einem anderen Land angesiedelt werden; die EU spricht von Relocation, wenn schutzbedürftige Personen von einem EU-Staat in einen anderen EU-Staat umgesiedelt werden. Österreich beteiligte sich zwischen 2013 und 2017 an Humanitären Aufnahmeprogrammen (HAP) des UNHCR für syrische Flüchtlinge und ermöglichte über diesen Pfad insgesamt 1.900 Menschen dauerhaft Schutz.
Beteiligung aus europapolitischen Erwägungen
Das erste Relocation-Programm (2015-2018) geht auf die Fluchtzuwanderung 2015 zurück und wird primär als Solidaritätsmaßnahme innerhalb der EU diskutiert, konkret von einigen Ländern gefordert und von vielen anderen strikt abgelehnt. Das erste Programm sah vor, 160.000 Menschen von Italien und Griechenland zu transferieren, tatsächlich waren es ca. 34.000 Menschen. An diesem Programm nahm Österreich zumindest symbolisch teil – aus Italien wurden circa 50 Geflüchtete aufgenommen. Der ÖVP-Innenminister in der damaligen SPÖ-ÖVP-Regierung argumentierte im März 2017, dass Relocation zwar falsch sei, dass sich Österreich aber aus europapolitischen Erwägungen beteiligen müsse.
„Koalition der Willigen“
Das zweite Relocation-Programm ab 2018 scheiterte weitgehend. Einige EU-Mitgliedsstaaten trugen die mit einer Mehrheitsentscheidung im Europäischen Rat getroffene Entscheidung nicht mit (Polen, Ungarn, Tschechien), sodass der deutsche Innenminister (CDU) den Vorschlag der „Koalition der Willigen“ einbrachte (2020). Diese schlossen sich Deutschland, Frankreich, Finnland, Luxembourg, Portugal, Irland und die Niederlande an. Dennoch ist die europäische Abwehr von Geflüchteten groß. Nach IOM-Berichten dürften über dieses Relocation-Programm im Jahre 2020 nur wenig mehr als 1.000 Menschen ein Aufenthaltsland gefunden haben als gleichzeitig in Lagern an der europäischen Außengrenze ca. 50.000 Menschen lebten.
„Konsequenter Kurs“ in Migrations- und Asylangelegenheiten
Ab 2018 lehnte die ÖVP/FPÖ-Bundesregierung jegliche Aufnahme ab. Der FPÖ-Innenminister sprach von Hilfe vor Ort, von Sog-Effekten und forderte den Schutz der EU-Außengrenzen als Antwort auf Fluchtkrisen. Diese Position führte die Ende 2019 gebildete Bundesregierung zwischen ÖVP und Grünen konsequent weiter. Die mitregierenden Grünen suchten zwar nach Gesprächen mit dem Regierungspartner und Lösungen jenseits der Aufnahme, wie Erhöhung des Katastrophenfonds. Die strikte Ablehnung von Resettlement- und Relocation-Geflüchteten ist für den türkisen Teil der Regierung aber Beleg für den im Regierungsprogramm festgehaltenen“ konsequenten Kurs“ in Migrations- und Asylangelegenheiten.
Argumentativer Unterschied
Gegen diese starre, anti-humanitäre Haltung formierten sich, insbesondere nach dem Brand in Moria im September 2020, zivilgesellschaftliche Plattformen und Initiativen. Diese versuchten die Bundesregierung für die Aufnahme von zumindest einigen hundert Personen zu bewegen – sie scheiterten aber. Beide Seiten, die ÖVP-geführte Bundesregierung ebenso wie die zivilgesellschaftlichen Initiativen, plädieren für Hilfe vor Ort – allerdings ist der jeweilige Ort an unterschiedlichen Orten situiert. Die ÖVP-Regierungsmitglieder sehen den Ort der Hilfe in den Lagern dort vor Ort und bringen diese angekündigte Hilfe gegen die Aufnahme in Stellung. Die zivilgesellschaftlichen Initiativen fordern Hilfe vor Ort hingegen hier, in den österreichischen Gemeinden und Städten. Der argumentative Unterschied zwischen Bundesregierung und Zivilgesellschaft ist die Möglichkeit von Migration, also Wechsel des Aufenthalts.
Alternativen zu prekärem Leben
Die Bundesregierung macht das äußerst prekäre Leben in Lagern zur langfristigen Lösung in Europa. HAPs in Form von Resettlement- und Relocation-Programmen sind Alternativen dazu, sie ermöglichen reguläre Wege der Zuwanderung aufgrund von internationalem Schutz.
Rosenberger, Sieglinde (2021): Umstrittene Relocation aus Moria: Proteste gegen die konservativ-grüne Regierungspolitik in Österreich. In: Forschungsjournal für soziale Bewegungen, Heft 4 (im Erscheinen). Siehe http://forschungsjournal.de
SOS Mitmensch hat gemeinsam mit Expert*innen und Betroffenen eine große Kampagne für die Wiederaufnahme von humanitären Aufnahmeprogrammen für besonders schutzbedürftige Menschen gestartet. Wir wollen die humanitäre Tradition Österreichs wiederbeleben und Menschenleben retten!
Jetzt den SOS Mitmensch Newsletter abonnieren
Ermöglichen Sie mit einer Spende unsere weitere Menschenrechtsarbeit



