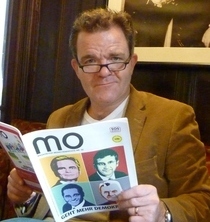Streng, strenger, Österreich
Lange Wartezeiten, aufwändige Beantragung, hohe Kosten: Menschen, die die österreichische Staatsbürger*innenschaft beantragen wollen, werden mit vielen Hürden konfrontiert. Was sie erleben und warum das strenge Gesetz nicht mehr zeitgemäß ist. Ein Beitrag im neuen MO-Magazin für Menschenrechte. Text: Lisa Winter, Illustration: Diana Bobb
Olga Kosanović ist in Wien geboren und aufgewachsen. Sie hat ihren Lebensmittelpunkt, ihre Familie, ihre Freunde und Freundinnen in der Stadt. Das Einzige, was sie von ihren österreichischen Freund*innen unterscheidet, ist der serbische Pass. Ihr Antrag auf die Staatsbürgerinnenschaft wurde aber erstmal abgelehnt. Durch die #hiergeboren-Initiative hatte ihr Fall zuletzt mediale Aufmerksamkeit bekommen, da die Behörde ihre Integrierbarkeit angezweifelt hatte. Die Begründung für die Ablehnung lautete nun: Sie habe in den letzten 15 Jahren zu viel Zeit außerhalb Österreichs verbracht. Die Empfehlung der Behörde: abwarten, so wenig wie möglich ins Ausland verreisen. „Ich hätte mir nicht erträumen können, dass das passiert“, sagt Kosanović immer noch sichtlich fassungslos. Das Bachelor-Studium in Hamburg wurde der 26-jährigen Regisseurin zum Verhängnis. Laut Gesetz darf sie nur maximal 20 Prozent der für den Antrag relevanten Zeit im Ausland verbringen. Sie liegt knapp darüber.

„Die Anträge dümpeln dort oft jahrelang herum.“ Die Rechtsanwältin Julia Ecker über die MA 35 in Wien.
„Österreich hat ein extrem strenges Staatsbürgerschaftsgesetz, das nicht mehr zeitgemäß ist“, sagt Julia Ecker. „Hinzu kommt eine sehr strenge Auslegung des Gesetzes durch die Behörden.“ Sie ist Vorstandsmitglied bei SOS Mitmensch und arbeitet seit etwa 10 Jahren als Rechtsanwältin im Bereich des Fremden- und Asylrechts. Sie betreut unter anderem Menschen aus Wien, die Staatsbürger*innen werden wollen. Diese fühlen sich häufig von der Magistratsabteilung 35, Fachbereich für Einbürgerung und Staatsbürgerschaft, diskriminiert. „Mein Eindruck ist eher, dass die MA 35 alle Menschen gleich (schlecht) behandelt“, so Ecker. Ihre Liste mit Kritikpunkten ist lang. Angefangen beim komplizierten Beantragungsprozess, langen Wartezeiten bei der Bearbeitung, sprachlichen und finanziellen Hürden, bis hin zur Verhinderung von Doppelstaatsbürgerschaften.
Der größte Rückgang in Wien
Wie eine Studie des Migrant Integration Policy Index zeigt, gehört Österreich im internationalen Vergleich zu den Ländern mit dem schwierigsten Zugang zur Staatsbürgerschaft. 2020 wurden insgesamt 8.996 Menschen eingebürgert. Das waren Statistik Austria zufolge rund 15 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit ist die Einbürgerungsrate auf unter 0,6 Prozent gesunken. Der größte Rückgang wurde in Wien verzeichnet. Hat Österreich kein Interesse daran, Menschen einzubürgern? „Es erweckt auf jeden Fall nicht den Eindruck, als sei es den Behörden ein Anliegen, rasch Staatsbürgerschaften zu verleihen“, sagt Ecker.

Istvan Szilagyi, Unternehmer, seit 2002 in Wien. Seit 2017 wartet er auf seinen Pass.
Diesen Eindruck teilt auch Istvan Szilagyi. Seit 2002 lebt er in Wien. Laut seinem Pass ist er ungarisch, fühlt sich mit dem Land jedoch nicht verbunden. Aufgewachsen ist er in Deutschland, bevor er seinen Lebensmittelpunkt nach Wien verlagerte. 2012 gründete er sein eigenes Unternehmen, in seinem Büro im 10. Bezirk beschäftigt er mittlerweile 12 Angestellte. 2017, zwei Jahre nach dem langen Sommer der Migration, hat er die Staatsbürgerschaft beantragt. „2015 ist mir die ungarische Regierung so auf den Arsch gegangen, dass ich gedacht habe, jetzt möchte ich mit dem Land keine Verbindung mehr haben.“
Nach Abgabe der Unterlagen vergingen eineinhalb Jahre, bis sie sich erneut bei ihm meldeten, weitere Dokumente einforderten. Auf den österreichischen Pass wartet er immer noch. Der letzte Stand ist, dass nicht nachvollzogen werden könne, wie er seinen Lebensunterhalt beziehe. Für Szilagyi ist das bei einem Jahresumsatz von 800.000 Euro unbegreiflich. Durch die Selbstständigkeit weiche sein Fall von anderen ab. Dass überfordere seine Sachbearbeiterin bei der Einkommensprüfung, so sein Eindruck. Eine Rückmeldung auf seine letzte E-Mail steht seit längerem aus. „Ich weiß, dass ich zu einer sehr privilegierten Gruppe gehöre. Dann komm ich in so ein Amt, irgendeine Frau guckt sich meinen Pass an und ich bin plötzlich in der unteren Schublade.“

RA Julia Ecker: „Mein Eindruck ist, dass die MA 35 alle Menschen gleich (schlecht) behandelt.“
MA 35: „ressourcenintensive Abläufe“
Die meisten Mandant*innen von Julia Ecker melden sich bei ihr, weil sie allein nicht weiterkommen und bei der MA 35 in Wien niemanden erreichen. „Die Anträge dümpeln dort oft jahrelang herum“, so Ecker. Auf Anfrage des MO Magazins erklärt Karin Jakubowicz, Sprecherin der MA 35, dass die Covid-Pandemie zu „ressourcenintensiveren Abläufen und einem beträchtlichen Mehraufwand“ geführt habe. Doch die meisten Personen, die dem MO Magazin für diese Recherche von ihren Erfahrungen erzählt haben, haben ihre Anträge lange vor der Pandemie eingereicht. Hinzu kämen „die immer komplexeren rechtlichen Vorgaben“ für die Verleihung der Staatsbürgerschaft heißt es in der schriftlichen Stellungnahme von Jakubowicz weiter. „In die Zuständigkeit der MA 35 fällt die Vollziehung der Bundesgesetze.“ Ein Ermessenspielraum bestehe dabei nicht.
Dass der Vorgang in Österreich komplex und schwer verständlich sei, kritisiert auch Julia Ecker. Meist verstünden die Menschen gar nicht, was von ihnen verlangt werde. Es sei nicht einfach, alle erforderlichen Unterlagen zusammenzutragen. Die Klassiker seien Versicherungs- oder Meldelücken, die Jahre zurückliegen. Oder Unterlagen, die nur schwer zu besorgen seien, wie Strafregisterbescheinigungen oder Beglaubigungen aus anderen Staaten. „Alles, was zumutbar ist, muss besorgt werden. Und was zumutbar ist, entscheidet die Behörde“, so Ecker. Oft auch über den für den Antrag relevanten Zeitraum hinaus. Hinzu komme, dass sich Antrag-steller*innen mindestens 80 Prozent der Zeit rechtmäßig in Österreich aufhalten müssen. Vor allem Hier Geborene, die internationale Karrieren verfolgen, stellt das vor große Schwierigkeiten. „Das Gesetz ist in solchen Fällen wenig flexibel und nicht mehr zeitgemäß“, so Ecker.
Auch die erforderlichen Nachweise zu den Einkünften stoßen bei Ecker auf Kritik. Ziel dieser Regelung sei es, die wirtschaftliche Absicherung der Personen zu gewährleisten. Dabei würden jedoch finanzielle Ressourcen, wie Eigentumswohnungen, Ersparnisse oder Unterhaltszahlungen nicht berücksichtigt. Das würde beispielsweise Studierende ausschließen, die kein festes Einkommen hätten, aber durch ihre Eltern finanziell abgesichert seien. Oder vermögende Personen mit geringem laufendem Einkommen. Auch für Geringverdienende und Arbeitslose ist der Zugang zur Staatsbürger*innenschaft generell schwer.

Azade Soltan: Nach 20 Jahren in Österreich ist er immer noch „der Flüchtling“.
Im Jahr 2000 flüchtete Azade Soltan aus dem Iran nach Österreich. Seit 2007 ist Soltan anerkannter Flüchtling, ein Jahr später folgte der Antrag auf die Staatsbürger*innenschaft, 2020 kam der negative Bescheid. Zunächst verdiente Soltan nicht genug. Die Behörde riet dazu, eine besser bezahlte Arbeit zu finden. „Ich bin Taxi gefahren“, erzählt Soltan, „50 Stunden in der Woche.“ Soltan wurde krank, verlor die Arbeit. Der Antrag auf Staatsbürger*innenschaft wurde stillgelegt, Soltan suchte sich Rechtsbeistand. Doch vermeintliche Versicherungslücken, angebliche Falschaussagen beim ersten Antrag und Arbeitslosigkeit verwehren den Zugang zum österreichischen Pass. „Seit ich in Österreich bin, passe ich mich an und integriere mich. Doch auch nach 20 Jahren bin ich noch immer der Flüchtling.“
Julia Ecker fordert, dass die Verleihung der Staatsbürgerschaft sowohl auf der gesetzlichen Ebene als auch in der Praxis reformiert wird. So müssten beispielsweise die Einkommenserfordernisse flexibler gestaltet werden, genauso die Regelungen bezüglich des Aufenthaltes. Auch brauche es mehr Rücksicht auf Härtefälle. Die Arbeitsbedingungen in der Behörde müssten verbessert, Abläufe gestrafft werden. „Und in der Praxis sollte das ohnehin strenge Gesetz nicht noch überinterpretiert werden“, sagt Ecker.

Olga Kosanovic, Regisseurin aus Wien. Der MA 35 missfällt das Bachelor-Studium in Hamburg.
Während der Befragung durch die Behörde hat sich Olga Kosanović unwohl gefühlt. Ständig habe sie Angst gehabt, etwas Falsches zu sagen und hatte das Gefühl sich rechtfertigen zu müssen. Dabei habe sie gelebt, wie jede andere Wienerin auch, sagt sie. „Ich möchte endlich auch von meinem demokratischen Grundrecht Gebrauch machen. Ich war noch nie in meinem Leben wählen.“
Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo